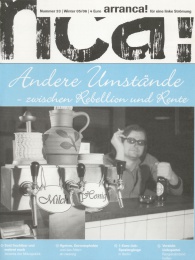Pränatale Diagnostik – Eugenik von unten?
Nicht nur die 35-Jährigen trifft es. Inzwischen wird jede Schwangere mit einem breiten Angebot an pränataler Diagnostik konfrontiert. Viele Frauen entscheiden sich für solche Untersuchungen. Was bewegt sie dazu? Welche Konsequenzen haben diese für sie selbst und für die Schwangerschaft? Wie gerät die Einzelne in den Strudel der medizinischen Angebote? Die Schwangere als Opfer der MedizinerInnen? Oder doch eher bewusste Teilnehmerin an einer „Selektion“ zwischen „behinderten“ und „gesunden“ Menschen?
Und: Wie verhält sich die politisch aktive Linke in der Debatte um pränatale Diagnostik und angrenzende Themengebiete wie Präimplantationsdiagnostik und späte Schwangerschaftsabbrüche? Wie verhält sie sich gegenüber dem neuen Aufleben der konservativen LebensschützerInnen, die im Zuge der aktuell von CDU/CSU geführten Diskussionen um späte Schwangerschaftsabbrüche das gesamte Abtreibungsrecht erneut in Frage stellen wollen?
Unzählige Fragen. Was hier versucht werden soll, ist einen kleinen praktischen Abriss über die Breite der Diskussion zu geben und zu reflektieren, wie wir vor dem Hintergrund wachsender sozialer Entsicherung, von Ideologien des Selbstmanagements und individueller Vorsorge als Betroffene und gesellschaftskritische Linke mit diesem Thema umgehen können.
Prä-natal
„Prä-natal“ im wörtlichen Sinn bedeutet „vor der Geburt“. Im weitesten Sinne sind damit alle diagnostischen Maßnahmen vor der Geburt eines Kindes gemeint. So fällt, streng genommen, auch die so genannte Präimplantationsdiagnostik im Rahmen einer In-Vitro-Fertilisation, d.h. einer künstliche Befruchtung außerhalb des Körpers, darunter. Diese Maßnahmen eröffnen erstmalig die Möglichkeit einer von Foucault als „positive Eugenik“ bezeichnete Selektion. Positiv in dem Sinne, dass nicht „Schlechtes“ vernichtet wird, sondern nur „Gutes“ als auserwählt erklärt wird.
Weitere Themen, auf die in diesem Artikel jedoch nicht eingegangen werden kann, sind Embryonenforschung, therapeutisches Klonen, ungewollte Kinderlosigkeit und die „Verrohstofflichung“ der Frau als Eizellenspenderin für die Forschung. Der folgende Beitrag beschränkt sich auf die bereits eingenistete Schwangerschaft und alle dafür angebotenen diagnostischen Verfahren. Dazu gehören zum einen die in der BRD in den „Mutterschaftsrichtlinien“ vorgeschriebenen Untersuchungen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, und zum anderen Untersuchungen, die im Rahmen so genannter „individueller Gesundheitsleistungen“ auf Wunsch und Kosten der Schwangeren durchgeführt werden.
Zu ersteren gehören neben drei Ultraschalluntersuchungen die Bestimmung der Blutgruppe inklusive der Antikörper, die Feststellung eines Kontakts der Schwangeren mit Röteln, Hepatitis B, Chlamydien (Sexually Transmitted Disease) und Treponema Pallidum (Syphilis), regelmäßige Gewichts-, Blutdruck- und Urinuntersuchung sowie das Erkennen von so genannten Risikogruppen, denen dann weitere pränatale Diagnostik angeboten werden muß. Die Schwangere geht dafür mit der Frauenärztin bzw. dem Frauenarzt einen Behandlungsvertrag ein, der die Betreuung der Schwangeren und die Betreuung des Embryos bzw. Fötus miteinbezieht. Eine pränatale Diagnostik, die darüber hinausgeht, ist laut den Richtlinien der Bundesärztekammer sinnvoll und geboten, wenn dadurch eine Erkrankung oder Behinderung des Kindes schon vor der Geburt behandelt oder rechtzeitig für eine postnatale Therapie gesorgt werden kann. Also nicht, um so früh und so perfekt wie möglich eine Schwangerschaft abzubrechen.
Üblicherweise meint pränatale Diagnostik (PND) den Organ- oder Fehlbildungsultraschall um die 22. Schwangerschaftswoche (SSW), das so genannte Ersttrimesterscreening (Nackenfaltenmessung mit Hormonbestimmung zwischen der 11. und der 14. SSW), den Triple-Test (Hormonuntersuchung für Risikoabschätzung von Trisomie 21: Down-Syndrom und Neuralrohrdefekten) und die invasiven, also in den Körper eingreifenden Untersuchungsmethoden wie die Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung), die Nabelschnurblutentnahme, die Chorionzottenbiopsie (Probeentnahme vom Mutterkuchenvorläufer), die Organbiopsie (-untersuchung) sowie die Fetoskopie (Spiegelung des ungeborenen Kindes in der Gebärmutter).
Wahrscheinlichkeitsberechnungen und Hintergrundsrisiken: Schwangerschaft auf Probe?
Geht eine Schwangere auf das Angebot von PND ein, wird sie mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen in Bezug auf das Risiko für das Vorliegen einer chromosomalen Störung konfrontiert. Zahlen, mit denen sie meist nicht viel anfangen kann: Welche Folge hat es, wenn vermittelt wird, es läge ein statistisches Hintergrundrisiko von 1:325 für ein Kind mit Trisomie 21 vor, während das adjustierte, also das nach der Untersuchung neu ausgerechnete Risiko bei 1:195 liegt? Wozu soll man sich entscheiden? Auf Basis eines Ultraschalls sind verlässlichere Diagnosen nie möglich.
Dazu kommt, dass die meisten Erkrankungen, die durch einige invasive diagnostische Untersuchungen (z.B. Amniozentese, Chorionzottenbiopsie) festgestellt werden können, nicht behandelbar sind. Es kann zwar festgestellt werden, dass eine Erkrankung vorliegt, die einzige Folge kann jedoch lediglich der Abbruch der Schwangerschaft sein. Das Absurde dabei ist, dass das Risiko einer Fehlgeburt nach einer invasiven Diagnostik je nach Technik immerhin auch bei bis zu 3% liegt und sich dadurch im schlechtesten Fall die Diskussion um einen möglichen Schwangerschaftsabbruch erledigt.
Der Abbruch einer Schwangerschaft aufgrund einer Erkrankung bzw. „Behinderung“ des Ungeborenen ist 1995 als „embryopathische“ Indikation aus dem §218 StGB gestrichen worden und damit nicht mehr legal. Der gebräuchliche Umweg, trotzdem eine Schwangerschaft nach PND abzubrechen, ist die Anwendung der so genannten „medizinischen“ Indikation, die davon ausgeht, dass der Abbruch einer Schwangerschaft nicht rechtswidrig ist, wenn durch die Fortführung der Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder den körperlichen bzw. seelischen Gesundheitszustand der Schwangeren zu befürchten ist.
Ein paar Zahlenspielereien: Etwa die Hälfte aller auffälligen Befunde nach einer Fruchtwasseruntersuchung ergibt die Diagnose „Trisomie 21“. Eine Trisomie 21 tritt etwa einmal bei 650-700 Geburten auf. Die Wahrscheinlichkeit für eine 25-jährige Frau ein Kind mit Trisomie 21 zu erwarten, liegt bei unter 0,1%, mit 35 Jahren bei 0,3%, mit 40 bei 1% und mit 48 Jahren bei 9%. Die meisten Kinder mit Trisomie 21 werden in Deutschland von Frauen, die jünger sind als 35, geboren, da diese jüngeren Frauen immer noch vergleichsweise wenig pränatal erfasst werden. Bei pränataler Erkennung werden 95% der Feten mit Trisomie 21 abgetrieben. Zu den zweithäufigsten chromosomalen Besonderheiten gehören Geschlechtschromosomabweichungen wie das Turnersyndrom (ca. 1:2500 bei Mädchen) und das Klinefelter-Syndrom (ca. 1:650 bei Jungen)1. Außerdem treten mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:350 relativ häufig Neuralrohrdefekte („Offener Rücken“ oder Spina bifida) auf.
Lediglich 1% aller „Behinderungen“ oder Erkrankungen können während der Schwangerschaft erkannt werden. 95-97% aller Säuglinge kommen bei der Geburt völlig gesund zur Welt. Der größte Teil der Kinder mit „Behinderungen“ oder Erkrankungen (ca. 95%) erwirbt diese erst während der Geburt oder im Verlaufe des Lebens. Beeinträchtigungen wie Cerebralparesen2, Lernschwächen, Verhaltensauffälligkeiten usw. entstehen beispielsweise durch Sauerstoffmangel und Infektionen während bzw. nach der Geburt oder durch eine Frühgeburt.
Umso absurder ist es, dass es in der pränatalen Diagnostik meistens nur um eine Fehlbildungssuche geht. Wirklich therapeutische Konsequenzen wie eine intrauterine Transfusion oder Operation von beispielsweise Zwerchfellhernien (-bruch), eine vorzeitig geplante Entbindung gegebenenfalls auch per Kaiserschnitt, die Geburt in einem Zentrum mit Neonatologie(Neugeborenen)- oder Kinderchirurgieabteilung, Erkennen und Behandeln von Schwangerschaftsdiabetes oder Ähnliches ergeben sich selten.
Folgen sind, dass das Schwangerschaftserleben sich immer mehr verändert: Es überwiegt nicht mehr die Freude über die erhoffte Schwangerschaft, sondern das Bangen darum, dass z.B. das Ergebnis des Ersttrimesterscreenings gut ausfällt. Das eigene Körpergefühl wird durch die technisierte Diagnostik beeinflusst, bestätigt oder in Frage gestellt.
Angebot und Nachfrage
Ultraschallspezialpraxen und Pränataldiagnostikzentren sprießen zurzeit geradezu aus dem Boden. Die Motivationen für die Durchführung und die Nutzung dieser sind vielfältig:
Zunächst bekommt man von GynäkologInnen die Aussage zu hören, dass doch jede Frau heutzutage ein Recht habe, ein absolut gesundes Kind zu bekommen. Andererseits kann die Frage gestellt werden, ob die wirkliche Motivation der Gynäkologenzunft doch eher im Zusatzverdienst über den Verkauf individueller Gesundheitsleistungen zu finden ist.
So steht hinter dem Ersttrimesterscreening beispielsweise ein breit angelegtes, kommerzielles Zertifizierungssystem der „Fetal Medicine Foundation“. Der Verkauf der für ein Ersttrimesterscreening benötigten Software und die dazugehörige Zertifizierung bescheren dieser privaten Organisation große Einnahmen. Die GynäkologInnen erlangen durch die Zertifikate Wettbewerbsvorteile und natürlich Kosten, die sie an Ihre Patientinnen weiterzugeben versuchen.
Auch die juristische Absicherung der ÄrztInnen selbst, die zur zunehmenden Ausweitung der Indikation auf Nicht-Risikogruppen und zur schleichenden Herabsetzung der Altersgrenzen führt, spielt eine Rolle. So gab es schon Urteile des Bundesgerichtshofes, die ÄrztInnen zu Schadensersatzzahlungen an Eltern verpflichteten, weil diese angeblich unzureichend über die Möglichkeiten pränataler Diagnostik aufgeklärt wurden.
Für die Schwangere wiederum kann PND ein Mittel sein, die Schwangerschaft selbstbestimmter und vermeintlich autonomer gestalten zu können, das „perfekte“ Schwangerschaftserlebnis zu haben. Zudem verspricht PND, Leben planbarer und sicherer zu machen. Ob motiviert durch Flexibilitätsdruck im Arbeitsleben, durch den gesellschaftlichen Zwang oder den eigenen Willen, die Reproduktionsbiographie zu planen, sei dahingestellt. Frau möchte eben nicht nur planen, wann sie ein Kind oder wie viele sie bekommt, sondern auch was für ein Kind sie erwartet. Allerdings wird diese Selbstbestimmung von den Frauen oft auch als paradox und als „Entscheidungsfalle“ wahrgenommen: Zum einen wird es unausweichlich, sich entscheiden zu müssen und zum anderen muss die getroffene Entscheidung ebenso unausweichlich verantwortet werden. Dem wird entgegengesteuert, indem im Rahmen immer früher einsetzender und verfeinerter Diagnoseverfahren ein geringeres Konfliktpotenzial vorgegaukelt wird: Durch frühere Diagnostik werden frühere Abbrüche möglich. Diese sind dann legal, wenn sie im Zeitfenster der Schwangerschaftskonfliktberatung bis zur 14. Schwangerschaftswoche stattfinden.
So wird die Hemmschwelle zur Nutzung von PND immer weiter herabgesetzt: In der gesellschaftlichen Debatte wird sowohl Schwangeren als auch ÄrztInnen vermittelt, dass die Geburt eines Kindes mit Behinderung ein volkswirtschaftlich „vermeidbarer Schaden“ ist. Das geht hin bis zur Forderung nach einer Schadensersatzpflicht der Eltern, wenn sie wissentlich ein behindertes Kind zur Welt bringen. So werden angesichts der Debatte um knappe Kassen der Sozialversicherungen die (potenziellen) „LeistungsempfängerInnen“ zu bewusstem Verhalten bezüglich der Gesundheitskosten angehalten.
Kinder bedeuten für viele eine Bedrohung ihrer materiellen Sicherheit. Dies spitzt sich bei der Vorstellung zu, mit einem Kind mit einer so genannten Behinderung leben zu müssen. Angesichts der vorherrschenden neoliberalen Ideologie von Leistungsfähigkeit und Eigenverantwortung ist die Furcht werdender Eltern gar nicht so aus der Luft gegriffen, ein Kind mit Behinderung könnte ihnen als persönliches Versäumnis angelastet werden.
En vogue ist pränatale Diagnostik und Präimplantationsdiagnostik zunehmend aber auch, weil der Anteil an so genannten Risikoschwangerschaften gestiegen ist. Diese Entwicklung ist zurückzuführen auf immer mehr künstliche Befruchtungen bei immer älteren Paaren mit abnehmender Fertilität, die sich erst nachdem die Karriere unter Dach und Fach gebracht wurde ein Kind leisten wollen oder können.
Es ist also falsch, nur die Ärzteschaft und die neuen Technologien an den Pranger zu stellen und die schwangere Frau als Opfer und hilflos Ausführende einer „Eugenik von unten“ darzustellen. Die strukturellen gesellschaftlichen Zwänge, die hinter der „freiwilligen“ Eugenik stehen, sollten vielmehr stärker in die Diskussion einbezogen werden.
Und jetzt? Politische Forderungen und mikropolitische Handlungsanweisungen
Schwanger werden wollen sollte im besten Falle auch die Auseinandersetzung mit den oben angeführten Aspekten pränataler Diagnostik bedeuten. Jede und jeder sollte sich bewusst sein, dass pränatale Diagnostik nur eine vermeintliche Entscheidungsoption ist und im schlechten Fall immer nur einen Ausgang findet: eine Abtreibung. Von daher ist pränatale Diagnostik eine Form von „Eugenik von unten“, also eine freiwillige Form von Eugenik.
Zu diskutieren ist, ob nicht gerade eine Linke - wissenschafts- und gesellschaftskritisch, emanzipiert und wahrscheinlich intellektuell gut ausgestattet - mit gutem Beispiel voran gehen sollte, von ÄrztInnen ausführliche Aufklärung zu fordern und auch selbstbestimmt Untersuchungen abzulehnen. Oder haben nicht gerade wir auch die Ressourcen, ein reflektiertes Leben mit einem Kind mit Behinderung zu führen und staatliche Unterstützung einzufordern, selbst wenn wir in prekarisierten Lebensumständen leben?
ÄrztInnen müssen standespolitisch Zeit für Beratungstätigkeit und bessere Ausbildung für diese einfordern. Sie müssen um sinnvolle Vergütungskonzepte kämpfen, damit nicht selektiv die Anwendung bestimmter Methoden aus rein kommerziellen Interessen und dadurch entsprechend tendenziöses Aufklärungsverhalten gefördert werden. Das Angebot sollte auf einen therapeutisch sinnvollen Einsatz der pränatalen Diagnostik beschränkt werden. Bildungsarbeit in Sachen reproduktiver Gesundheit, eine umfangreiche Aufklärung über Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und die zugehörige Diagnostik ist gesamtgesellschaftlich bitter notwendig. Es mangelt an unabhängigen, kompetenten und nichtkonfessionellen Beratungsstellen, die die Kompetenz von Schwangeren im Umgang mit den Angeboten der pränatalen Diagnostik frei von den ökonomischen Zwängen von ÄrztInnen erhöhen. Nicht zuletzt ist auch der Kampf um die Ausweitung sozialer Sicherungssysteme und den Ausbau von (kostenfreien) Betreuungseinrichtungen für „gesunde“ und „ungesunde“ Kinder eine Voraussetzung für eine angstfreie Schwangerschaft.
Wir müssen uns einmischen in die Diskussionen um „positive Eugenik“, Präimplantationsdiagnostik, Embryonenschutzgesetz und späte Schwangerschaftsabbrüche: Es darf kein Recht auf ein gesundes Kind geben! Vielmehr bedarf es der Anerkennung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Dazu müssen soziale Strukturen für ein Leben mit Kindern und ein Leben mit Behinderung gestärkt und geschaffen werden – von uns!
- 1. Als Klinefelter-Syndrom werden die Auswirkungen einer Chromosomenfehlverteilung bezeichnet, bei der zusätzlich zum normalen männlichen Chromosomensatz 46XY ein weiteres X-Chromosom in allen oder einer größeren Zahl der Körperzellen vorliegt. Beim Ullrich-Turner-Syndrom wiederum handelt es sich um eine Chromosomenfehlverteilung der Geschlechtschromosomen, von der nur Mädchen betroffen sind. Beide Chromosombesonderheiten gehen u.a. mit einer reduzierten Hormonausschüttung einher, die z.T. ein Ausbleiben der Pubertät (falls nicht Hormone eingenommen werden) und weitere, nicht immer schwerwiegende Besonderheiten zur Folge hat.
- 2. Schädigungen des Gehirns, die Störungen im Bewegungsapparat zur Folge haben.
Trackback URL für diesen Artikel
Erschienen in arranca! #33