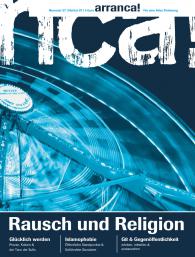Rausch, Sucht, Neoliberalismus
»[N]ur mit Hilfe von psychoaktiven Substanzen ist die Anpassung der Subjekte an die Beschleunigungskräfte der spätmodernen Gesellschaft zu gewährleisten. Dabei sollen diese Substanzen aber möglichst frei von Risiken sein und kontrollierbar bleiben, damit sie nicht zur ökonomischen Belastung werden.« Horst Gerhard in Jahrbuch Suchtforschung 2004
Schneller, lauter, härter. Die Überforderung in Permanenz, mit der einem der flexible Kapitalismus entgegentritt, verlängert die eigene Minderwertigkeit potentiell ins Unendliche. Im Fall der Überforderung durch ständig neue Leistungs- und Flexibilisierungsanforderungen, aber auch in anderen Fällen gewinnt die biochemische Beeinflussung und Steuerung des eigenen Körpers eine zunehmende Attraktivität. Darauf deutet auch der Wandel des Konsums hin – weg von Drogen und Präparaten mit Betäubungswirkung, hin zu stimmungsaufhellenden, leistungssteigernden und leistungsregenerierenden Drogen. Doch wie lässt sich das mit dem Idealbild der ökonomisch handelnden, absolut rationalen Nutzenmaximiererin vereinbaren? Steht Medikamenten- oder Drogenkonsum nicht im direkten Gegensatz zu diesen Persönlichkeitsanforderungen? Oder lassen sich Drogenkonsum und rationale Lebensführung vielleicht sogar ganz gut vereinbaren?
„Sucht“ im heutigen Sinne entstand erst im Zuge des 19. Jahrhunderts als medizinisch-soziales Krankheitsbild und stellte ein ambivalentes Phänomen dar. Zwar existierten zeitlich begrenzte, legitimierte Phasen des Rausches, aber es galt, immer die Balance zwischen Rausch und Selbstkontrolle zu halten. Gelang dies nicht, wurde man mit Verachtung gestraft und bekam es mit ihrer rationalisierten Variante in Form von Therapeutisierung und Medikalisierung zu tun. Traditionell wurde dem Drogenkonsum mit einer Steuerung über Verbote, Gebote und Belohnung begegnet. Das Versagen der Selbstkontrolle wurde mit Pathologisierung sanktioniert. Wie gestaltet sich nun der heutige gesellschaftliche Umgang mit dem Phänomen des Rausches und der Sucht?
Drogenpolitik in Deutschland
Zuerst ein Blick auf die Entwicklung der bundesdeutschen Drogenpolitik. In den 1970er Jahren, bis in die 1980er Jahre, war das Koordinatensystem der Drogenpolitik ein sehr simples. Bestimmend war die Gegensätzlichkeit von Abstinenz und Abhängigkeit. Es wurde eine zwangsläufige Entwicklung von Drogenkonsum zur Sucht unterstellt. Das Suchtpotential von Drogen stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und Süchtigen wurde eine defizitäre Persönlichkeitsstruktur unterstellt.
Dieses Bild bekam im Verlauf der 1980er Jahre deutliche Risse. Soziologische Untersuchungen des Drogenkonsums kamen zu dem Ergebnis, dass Drogenkonsumierende sich keineswegs in einer Abwärtsspirale zum „sozialen Verfall“ befanden, sondern komplexe neue Lebensstile kreierten und sich aktiv zu ihrer Situation verhielten. Auch der Zusammenhang von Drogenkonsum und Sucht wurde deutlich relativiert. Empirische Untersuchungen ergaben bei allen Drogentypen einen großen AnwenderInnenkreis mit kontrolliertem, nicht suchthaftem Drogenkonsum.1 Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei entgegen der anfänglichen Vermutung nicht um eine Vorstufe auf dem Weg zur Sucht, sondern um eine stabile Konsumvariante. Der Unterschied zwischen suchthaftem und kontrolliertem Drogenkonsum hing weniger mit dem Suchtpotential und den biochemischen Wirkungen der Droge zusammen als mit den individuellen Ressourcen der KonsumentInnen und der Einbettung in deren Alltag, z.B. über Konsumregeln und -rituale. Auch bei ehemaligen AlkoholikerInnen ist das Erlernen von kontrolliertem Alkoholkonsum, meist über ein Umfeld, das zu einer Normalisierung von Konsumregeln führt, in den häufigsten Fällen möglich (auch wenn die Anonymen Alkoholiker immer noch das Gegenteil behaupten). Es kam in der Folge zu einem Wandel der Wahrnehmung – die Konsumentin wurde nicht mehr als Sklavin der Droge betrachtet. Die Unterscheidung in harte und weiche Konsumformen erschien sinnvoller als die Unterscheidung zwischen harten und weichen Drogen.
Progressive Drogenpolitik verband mit diesen Feststellungen die Hoffnung auf eine baldige Legalisierung illegaler Drogen und deren kulturelle Einbettung in neue Drogenkulturen, ähnlich der Tee- oder Alkoholkultur. Legalisierung und Drogenerziehung wären die Grundlage dafür, einen bewussten Umgang mit Drogen überhaupt erst zu ermöglichen.
Im Verlauf der 1990er vollzog sich dieser Wandel teilweise auch auf der praktischen Ebene der Drogen- und Präventionstherapie. Das Ziel der Abstinenz geriet immer mehr in den Hintergrund und wurde durch Risikomanagement und das Bild der verantwortungsvollen Verbraucherin abgelöst. Aus Drogenprävention wurde Suchtprävention. Die Programme kontrollierten Drogenkonsums gehen davon aus, dass die KonsumentInnen in bestimmter Art und Weise mit Drogen umgehen und ihren Konsum jederzeit verändern können. „Der kontrolliert Konsumierende ist also Voraussetzung und Ziel der Programme zugleich.“2
Die staatliche Drogenpolitik hingegen blieb hauptsächlich bei einer Politik der Abschreckung durch die Betonung negativer Aspekte und dem Ziel der Abstinenz, anstatt sich für die Rückgewinnung der Selbstkontrolle von DrogenkonsumentInnen über das eigene Konsumverhalten einzusetzen.
Selbstkontrolle und Ökonomisierung des Sozialen
Das Konzept des kontrollierten Drogenkonsums fügte sich bestens in die zunehmende Ökonomisierung des Sozialen ein. Gingen die progressiven Spielarten noch von der zu unterstützenden Mündigkeit der Konsumierenden aus, die im Notfall therapeutisch oder durch Sozialarbeit abgesichert werden sollte, so denkt die, nennen wir sie neoliberale, Spielart des kontrollierten Drogenkonsums konsequent in ökonomischen Kategorien. Das Selbst als sein eigener Unternehmer. An die Stelle von Therapie und Sozialarbeit tritt der „unternehmerische Konkurs“ (Legnaro) und der teilweise Ausschluss vom Markt. Es handelt sich nicht mehr primär um einen Modus der Disziplinierung, sondern einen der Kontraktualisierung, also des – „freiwilligen“, aber vor allem verbindlichen – Vertrages. Das Individuum wird beobachtet und soll sich selbst beobachten und verbessern. Die geforderte Selbstoptimierung findet allerdings häufig nicht von selbst statt, sondern muss stimuliert und kontrolliert werden. Bei den schmaler werdenden Budgets sozialer Einrichtungen dürfte es nicht verwundern, wenn diese sich Wiederholungsfällen oder Fällen ohne „absehbaren Therapieerfolg“ nicht mehr annehmen und das Netz sozialer Arbeit zunehmend löchriger wird.
Sucht wird von dieser Variante als rationale Wahl mit bestimmten Vor- und Nachteilen angesehen. Das Konzept der Autonomie ersetzt das der Abhängigkeit. Dem Individuum wird seine Gesundheit selbst überlassen, auf dass es seine Pflicht, die so genannte „duty to be well“, erfülle, sich selbst verwalte und die eigene Gesundheit als die notwendige Grundlage seines unternehmerischen Selbstverhältnisses begreife. Dies impliziert nicht unbedingt Drogenabstinenz, sondern lediglich einen überdachten Umgang, eine aktive Aneignung und eine distinktive Inszenierung des Konsums. „[S]chließlich ist jede und jeder der shareholder des eigenen Körpers und bestimmt die erwünschte Lustdividende“3. Freiheit wird unter der Auflage der selbstverantwortlichen Nutzung verliehen.
Drogenkonsum hatte neben dem rebellischen Charakter eines „turn on, tune in, drop out“ (Timothy Leary) immer auch die Funktion, die Spannungen zwischen eigenen Lebensvollzügen und gesellschaftlichen Anforderungen zu minimieren. „Der Substanzgebrauch ist damit zu einer typischen Erscheinung einer lebensstilbewussten und zugleich leistungsorientierten Lebensweise geworden. Drogen wie Kokain und Ecstasy sind nicht das Andere der alltäglich geforderten Leistungsbereitschaft, sondern die bis zum Rausch gesteigerte Leistung.“4
Wie sich zeigt, ist der Konsum illegalisierter Drogen nicht zwangsläufig mit einer nonkonformistischen Haltung verbunden, sondern genauso mit den extremen Anpassungsleistungen der Selbstmedikalisierung.
Staatliche Kontrolle – Staatliche Akzeptanz
„Illegale Drogen sind zu einem integrierten Bestandteil der modernen Gesellschaft, zu einer unverzichtbaren Ingredienz ihrer Alltagskultur geworden – im Arbeitsbereich ebenso wie in den Lebenswelten und Szenen der Freizeit.“5
Drogenkonsum diente immer als Anlass für verstärkte Repression und der Kampf gegen den Drogenkonsum produzierte immer auch ein positives Bild von Normalität, Konformität und rationalem Handeln. Die These, die ich vertreten möchte, konstatiert einen Bruch in diesem Kontrollregime. Meiner Ansicht nach hat ein grundlegender Wandel von direkten Kontrollformen hin zu indirekteren Formen der Kontrolle stattgefunden. Die indirekten Kontrollformen arbeiten mit den Selbstführungen der Subjekte (und nicht mehr gegen diese). Dies bedeutet nicht, die neuen Formen würden gänzlich ohne direkte Formen der Kontrolle und Disziplinierung funktionieren. Den Individuen wird zwar rationales Handeln unterstellt, trotzdem wird dessen Versagen einkalkuliert. Im Fall des Drogenkonsums funktioniert diese Art der Kontrolle in Form eines Risikomanagements. Bestimmte Risikoprofile werden erstellt und ohnehin schon marginalisierte Gruppen einem generalisierten Verdacht unterworfen.
Die staatliche Politik der Drogenbekämpfung akzeptiert den Konsum illegaler Drogen in gewisser Art und Weise. Durch die Einrichtung von speziellen Räumlichkeiten für den Konsum illegaler Drogen – so genannten Gesundheitsräumen – akzeptiert man ein Stück weit dessen Unvermeidbarkeit und versucht diese ein- bzw. abzugrenzen und kontrollierbar zu machen.
Die Kontrolle des Drogenkonsums beschränkt sich auf eine Kontrolle der Sichtbarkeit und der Situationen. Wachkräfte in den Flaniermeilen des Konsums, Videoüberwachung, Untersuchungen über die Wirkung bestimmter Architekturen, klassische Musik und speziell gefärbtes Licht, z.B. auf den Toiletten des Hamburger Hauptbahnhofs, sind Momente einer neuen Kontrolltechnik, die versucht, über die Umgebungsvariablen Einfluss auf individuelles Handeln zu nehmen. Urinkontrollen am Arbeitsplatz sichern die Funktionalität und die Kombination von urbaner Überwachung und Fixerstuben minimiert die Sichtbarkeit. Bei der näheren Betrachtung dieser Kontrolltechniken wird deutlich, dass es nicht mehr um die Beseitigung des Drogenkonsums geht, sondern lediglich darum, das als unvermeidbar akzeptierte Phänomen zu ordnen. Es handelt sich nicht mehr um moralische Urteile, sondern um solche der situativen und räumlichen Unerwünschtheit. Einerseits gibt es also die deutliche Tendenz in Richtung einer Normalisierung illegalisierten Drogenkonsums, nichtsdestotrotz gehen damit weiterhin Momente von Misstrauen und Verdacht einher (Urinkontrollen bei der Vergabe von Methadon, neue Spritzen nur durch die Herausgabe alter, usw.).
Zusammenfassend lässt sich also eine zunehmende Normalisierung der Sucht und eine Entmoralisierung der Kontrolle feststellen. Ungeachtet dessen geht mit der Illegalisierung bestimmter Drogen immer noch ein Hauch von Verachtung einher, was sich unter anderem im Kontrast der standardisiert-sterilen Atmosphäre von Fixerstuben im Vergleich zu den differenzierten Gesundheitsräumen der AlkoholkonsumentInnen – von der bisweilen heimeligen Atmosphäre der Eckkneipe bis zur distinktiven Inszenierung der Lifestyle-Bar – ausdrückt.
Anmerkungen
1 Vgl. hierzu die Arbeiten von Norman E. Zinberg, Wayne M. Harding und Stanton Peele.
2 Brigitta Kolte und Henning Schmidt-Semisch in: Jahrbuch Suchtforschung 2006, S.15.
3 Aldo Legnaro in akzept & INDRO (Hg.), Gesellschaft mit Drogen. Akzeptanz im Wandel, Berlin 2001, S. 89.
4 ebenda.
5 Horst Gerhard in: Jahrbuch Suchtforschung 2004, S. 23.
Trackback URL für diesen Artikel
Erschienen in arranca! #37