Willkommen im Club der linken Versager
Zur Geschichte des realexistierenden Scheiterns
»Die Stunde der Niederlage bringt der Sowjetunion noch einen letzten Applaus. Es wird im Moment ihres Scheiterns, in ihrem Verzicht auf Rache und unnützes Blutvergießen jene friedliche und menschenfreundliche Utopie noch einmal erneuert, die den Kern der marxistischen Ideologie ausmacht und die durch die Bolschewiki zu Zeiten ihrer Macht so oft desavouiert worden ist.« (Rainer Bohn 1991)
Gemessen an dem Anspruch, Ausbeutung und Unterdrückung zu beenden und allen Menschen ein Leben ohne Hunger und Personalausweis zu ermöglichen, sind sie alle gescheitert – die Linken. Zuerst diejenigen, die sich von diesem Anspruch – meistens eher heimlich – verabschiedeten bzw. ihn verrieten. Sozialdemokratinnen also, gleich welcher Farbe, rot, grün oder ähnlich, und unabhängig davon, ob sie sich als Partei, Gewerkschaft oder Pfeifenclub organisierten. Dann all jene, die sich hiervon überhaupt verraten fühlen durften, weil sie dem Anspruch, die Welt einmal in Gänze nach links zu drehen, treu geblieben waren. Rätekommunistinnen oder Anarchafeministen, Republikanerinnen oder Kommunarden, die mutig auf die Barrikaden stiegen – und dort auch verblieben. Wenn sie nicht noch dahinter erledigt wurden von schließlich jenen, die gerade in ihrem Erfolg scheiterten, nämlich eher die Macht übernahmen, als die Welt zu verändern. Jene also, die sich – zunächst aber alle anderen – zu Tode siegten, Leninistinnen, (Post-)Stalinisten, Staatssozialistinnen.
Gescheitert sind sie alle, aber keiner will’s gewesen sein. Die Sozialdemokratinnen nicht, weil sie ja gar nicht gewinnen wollten, also auch eigentlich nicht verlieren konnten. Die Anarchistinnen nicht, weil an ihrer Niederlage nicht sie, sondern ausschließlich ihre Feinde die (moralische) Schuld trugen. Und die Kommunistinnen nicht, weil sich ihre Taten in der Gegenwart noch gar nicht, sondern erst aus der Perspektive der kommunistischen Zukunft beurteilen ließen. Eine noch völlig unbekannte kommunistische Zukunft, versteht sich, von der aber so viel bekannt war, dass sie noch das versauteste Mittel anerkennt, wenn es nur zum saubersten Zweck führt, welcher eben diese Zukunft selbst ist. (Dass die Sowjet- wie auch die DDR-Führung jede Statistik in eine optimistische umlog, bis sie selbst nicht mehr richtig rechnen konnte, lag vor allem am Misstrauen, dass sie ihren Untertanen entgegenbrachte. Im geschlossenen Kreis ließen sich Irrtümer leicht zugeben, denn diese fielen nicht weiter ins Gewicht vor der Geschichte großem Weltgericht).
Von hier aus lässt sich das gewaltige Seufzen 1989/91 verstehen, mit dem nicht nur ein Imperium abdankte, sondern auch dessen und – gemäß seines universalistischen Anspruchs – unser aller Zukunft. Für die Kommunistinnen, die immer auf die Gesetze des Fortschritts vertraut hatten, gab es plötzlich kein Vorwärts mehr und keine Flucht nach vorn. Wo vorher eine Kette von Begebenheiten erschien, da war im Blick zurück nur noch eine einzige Katastrophe zu sehen (Walter Benjamin), ein Schuldenberg, der unablässig Rechnung auf Rechnung häufte, welche nach 73 Jahren alle auf einmal fällig wurden.
Dabei brachte die Staatsverschuldung die DDR aus ökonomischer Perspektive bereits Ende der 1980er an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Ungefähr 1987 hatten Mitarbeiterinnen des Instituts für Wirtschaftswissenschaft der Akademie der Wissenschaften ausgerechnet, dass die Mittel für die sozialistischen Subventionen fast aller Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs – Brot und Brötchen, Milch, Nudeln und Schuhe, Mieten, Energie und Fahrpreise – in zwei Jahren nicht mehr ausreichen würden. Damit war vorherzusehen, dass der von Reagan 1981 proklamierten Strategie, die Sowjetunion im Wettrüsten zu besiegen, ein baldiger Erfolg beschieden sein würde. Da die Oststaaten die Investitionen in Hochtechnologie kaum verkraften konnten und auch der Bau jedes konventionellen Panzers den doppelten Aufwand erforderte – die Arbeitsproduktivität der UdSSR lag etwa 50 Prozent unter derjenigen der USA –, war die ökonomische Niederlage des real existierenden Sozialismus absehbar.
Die Niederlage, nicht jedoch das Scheitern. Denn gescheitert war der Sozialismus, der sich bekanntlich nicht in erster Linie über die Entfaltung der Produktivkräfte, sondern über die Umwälzung der Produktionsverhältnisse definiert, bereits viel früher: mit der Entmachtung der Räte, der Bürokratisierung der Ökonomie, der Aufgabe der Arbeiterkontrolle, der Unterdrückung der Gewerkschaften. Das Ziel der klassenlosen Gesellschaft war mit dem Verbot der Arbeiteropposition und der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands, die beide wenig mehr getan hatten, als an diese sozialistischen Versprechen der Oktoberrevolution zu erinnern, schon 1921 gestorben. 1989/91 markierte so nur das letzte Offenkundigwerden dieses Todes, der bereits ein halbes Jahrhundert zuvor eingetreten und lediglich propagandahaft überschminkt worden war.
Als Scheitern konnte dieses Ableben eines Zombiesozialismus nur erscheinen, weil die sozialistischen Staaten die Devise ausgegeben hatten, die kapitalistische Konkurrenz zu »überholen ohne einzuholen«, wie es Walter Ulbricht bereits 1957 formulierte. Dabei war klar, dass die sozialistischen Staaten keine Parallelökonomie jenseits des kapitalistisch organisierten Weltmarktes würden errichten können. Nur gemessen an dieser auf quantitative Produktivkraftentwicklung reduzierten, von den Konsumwünschen der Bevölkerung getriebenen Plan-Vorgabe, scheiterten die staatssozialistischen Regierungen.
Für die linken Oppositionen, die sich in mehr oder minder radikaler Distanz zu diesen Regierungen befanden, stellten sich die Ereignisse logischerweise anders da. Die Künstler-Bohème der DDR, die während der 1970er und 1980er Jahre um antiautoritäre Freiräume gekämpft und die erstarrten Konventionen künstlerisch subvertiert hatte, versickerte Ende der 1980er Jahre langsam im Westen oder ließ sich von den konzilianteren Kulturfunktionären vereinnahmen. Sie begrüßte nicht nur die Reformbemühungen in der DDR, sondern akzeptierte auch den Eintritt in den bundesrepublikanischen D-Mark-Markt, in dem sie sich teilweise recht schnell zu verwerten wusste. Die Bürgerrechtlerinnen, die sich vornehmlich im Rahmen des Protestes gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns konstituiert hatten und sich neben dem Kampf um Menschenrechte auch mit ökologischen Fragen beschäftigten, waren zusammen mit der Punkbewegung der stärksten staatlichen Repression ausgesetzt. Angesichts von Perestroika in der Sowjetunion und Massenflucht von DDR-Bürgerinnen über die ungarischen Grenzen in den Westen initiierten sie die Montagsdemonstrationen. In ihrer Mehrheit strebten sie eine Demokratisierung der DDR unter Beibehaltung der sozialen Errungenschaften an. Nach 1989 wurden die Bürgerrechtlerinnen grün, gingen zur CDU oder ließen sich als IM enttarnen. Fortan pflegten sie größtenteils einen aggressiven Antikommunismus. Die linke Opposition innerhalb der SED und die Intellektuellen suchten nach einer Reform des Sozialismus in der DDR, nicht zuletzt weil sie um die wirtschaftliche Prekarität des Systems wussten. Aber die Prognose der ökonomischen Krise war nicht gleichbedeutend mit der Prognose ihrer politischen »Lösung«. Die reaktualisierte Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlicherem Antlitz wurde im Übergang von »Wir sind das Volk« zum deutschnationalistischen »Wir sind ein Volk« hinweg gefegt. Die historisch gebildeten SED-Linken hatten sich nicht vorstellen können, dass die UdSSR sich so geräuschlos aus der DDR verabschieden und kurz darauf implodieren würde. Gelähmt mussten sie feststellen, »dass die politische Alternative zu 200 Jahren Menschheitsgeschichte so verschwand, wie es ihre Gegner höhnisch prognostiziert hatten: nicht mit einem Knall, sondern mit einem Winseln« (Jan-Philip Reemtsma 1991).
Mindestens ebenso überrascht waren die Linken im Westen. Für die autonome Linke formuliert Klaus Holz rückblickend: »Alle waren paralysiert und hingen vor der Glotze. Wer etwas anderes sagt, lügt.« Dies trifft selbst auf jene Teile der Linken zu, die ihre politische Glaubwürdigkeit gerne aus der Behauptung speisen, die zukünftigen Weltläufe vorhersagen zu können. Die Konkret-Ausgabe vom Oktober 1991 lässt eine Reihe prominenter Stimmen ihren Schock in Worte kleiden. Die Reaktionen auf das Scheitern des Putsches staatstreuer Kommunistinnen im August desselben Jahres, die versuchten, den Staatssozialismus und die Sowjetunion vor Gorbatschow zu retten, dadurch Jelzin an die Macht spülten und das Ende der Sowjetunion besiegelten, unterscheiden sich nicht zuletzt darin, wie nah die Autorinnen dem sowjetischen System standen.
Als Scheitern, im eigentlichen Sinn, wurde dieses Ende nur von jenen Teilen der westdeutschen Linken erfahren, die aus Gründen ideologisch-finanzieller Nähe »und der (wie sich zeigte: fehlgeschlagenen) Strategie an der UdSSR festgehalten« hatten (Georg Fülberth). Für jene vor allem aus dem Umfeld der DKP stammenden Marxistinnen-Leninisten, die »ihr Schicksal über drei Generationen mit dem roten Oktober verbanden, ist der Abgang des Realsozialismus, letztlich unter dem Druck breiter Massenbewegungen, ein traumatisches Ereignis« (Heinz Jung).
Im Gegensatz dazu konzipierte der Großteil der marxistischen Linken, der keinerlei Affinität zum poststalinistischen Sozialismus hatte, den Untergang der Sowjetunion als eine Niederlage. Eine Niederlage, von der nichtsdestotrotz »wir alle betroffen sind« (Winfried Wolf). Auch wer dem zusammengekrachten Regime »keine Träne nachweinte«, kam, wie Jan-Philip Reemtsma, nicht umhin den welthistorischen Charakter dieses Ereignisses anzuerkennen: »1789 war das Datum, das symbolisch steht für den Kampf um politische, 1917 für den um soziale Gleichheit. Der weltweit widerspruchslose Widerruf dieses Symboldatum markiert das Ende der Linken.« Noch trauriger formulierte Wolfgang Pohrt diese Erkenntnis: »Die endgültige Niederlage der Oktoberrevolution hieß, dass die Menschheit sich keine Hoffnungen mehr auf einen Zustand machen durfte, der sich grundlegend vom aus den Geschichtsbüchern schon bekannten unterscheiden würde.«
Für die autonome Linke, die wie etwa die Freiburger Ex-Anti-Nato Gruppe Sowjetunion und DDR jeden sozialistischen Anspruch absprach und sie mit dem Begriff des Staatskapitalismus zu fassen suchte, stand weniger der Begriff der Niederlage im Zentrum der Perspektive, sondern jener des Sieges – von Kapitalismus und Imperialismus. Nur vermittelt verband sich dieser Siegeszug mit einer Niederlage: dem Verlust vieler erkämpfter Freiräume, dem Abbau des Sozialstaats, auf dessen Stütze nicht nur viele Linke, sondern auch eine Vielzahl ihrer Projekte basiert hatte, der Einschränkung der Freiheitsrechte (Unverletzlichkeit der Wohnung - Art. 13 GG) und nicht zuletzt der de facto Abschaffung des Grundrechts auf Asyl (Art. 16 a GG), welche sich offiziell als Reaktion auf den Volks(gemeinschafts)willen legitimierte, der in den rassistischen Pogromen von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda (Ost), Solingen und Mölln (West) kundgetan wurde.
In der Revision der Nachkriegsordnung tauchte so mit Panik verbreitender Gewalt eine alte Frage wieder auf, die »Deutschenfrage« (Detlev zum Winkel). An ihr spaltete sich der den Neuen Sozialen Bewegungen nahe stehende Kommunistische Bund (KB) zum letzten Mal: in eine Fraktion, die in der Ostlinken und deren Partei eine Chance für Bündnispolitik erblickte und eine Fraktion, die sich im Zusammenschluss mit autonomen Gruppen als Radikale Linke unter der Parole »Nie wieder Deutschland« sammelte. Auch wenn der Begriff des »Vierten Reichs« aus der Diskussion bald wieder verschwand, bewahrheiteten sich die Anfang der 1990er diesbezüglich formulierten Prognosen mit erschreckender Präzision: Das deutsche Kapital machte große Teile Osteuropas zur verlängerten Werkbank, der deutsche Staat führte wieder Krieg und die deutsche Gesellschaft begrub »ihre NS-Vergangenheit unter den Trümmern des DDR-Staates« (Wolfgang Schneider 1991).
1989/1991 siegte der Antikommunismus über seine vielzähligen, unterschiedlichen und zerstrittenen Feinde. Der Kommunismus jedoch scheiterte nicht - sondern höchstens der letzte, schon gänzlich kraftlose Versuch seiner Rettung. In dieser Perspektive reiht sich das Datum ein in die nach dem Tod Stalins wiederaufgenommene Kette von Reformversuchen, die sich vom Aufstand in Ungarn 1956 bis zum Prager Frühling 1968 spinnt. Wie 1956 mit Chruschtschows Geheimrede kam auch diesmal die Hoffnung von oben, von Gorbatschows Glasnost und Perestroika, zaghaften Versuchen des Aufbrechens von Verkrustungen und der Entbürokratisierung, beginnend im Jahr 1987. Nur vier Jahre später, im August 1991, verbot Jelzin die KPdSU und beschleunigte das absehbare Ende der Sowjetunion. Das winzige Fenster für einen anderen Ausweg aus dem »sehr alten und auf Dauer ermüdenden Spiel, dessen Varianten Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg heißen« (Wolfgang Pohrt) hatte sich geschlossen.
Enzo Traverso hat in seinen »Gebrauchsanleitungen für die Vergangenheit« darauf aufmerksam gemacht, dass sich mit dem »Ende der Geschichte« auch die Erinnerungs- und Geschichtspolitik transformiert. In der DDR waren die Verfolgten des Nationalsozialismus in eine abgewertete Gruppe der Opfer des Faschismus und eine favorisierte Gruppe der Widerstandskämpfer gegen den Faschismus geteilt, von welchen letztere im antifaschistischen Staat nachträglich zu Siegern geworden waren. Mit dem Ende dieses antifaschistischen Staates verwandelten sie sich allerdings nicht in Besiegte. Denn an die Stelle der im Diskurs - nicht nur dem der Linken - populären Figuren von Siegern und Besiegten, war bereits das Paar von Täter und Opfer getreten.
Es ist dieselbe historische Bewegung, in welcher auch der Begriff des Scheiterns seinen Auftritt hat. Ebenso wie der Begriff des Opfers jenen der Besiegten verdrängt, geht der psychologische Diskurs des Scheiterns mit dem Verschwinden des politischen Begriffs der Niederlage einher. Mit einigem Recht darf somit danach gefragt werden, ob sich die Frage des Scheiterns nicht vor allem innerhalb der depolitisierenden Strategie des Neoliberalismus artikuliert, die mittels der Technik der Subjektivierung die Gesellschaft und ihre Kämpfe zum Verschwinden bringt. Zur gleichen Zeit eröffnet aber auch das neoliberale Dispositiv eine ihm eigene Perspektive auf Geschichte, die es im Moment seines Sturzes aufzuheben gilt. Denn die Niederlage wird denen, die sie erleidenden, von außen beigebracht, von einem überlegenen Gegner. Wer aus ihr lernen will, lernt, beim nächsten Mal mit einer verbesserten Taktik, einer gründlicheren Analyse, vor allem einer größeren Masse vorzugehen. Das Scheitern aber geht tiefer. Es ist – unter ideologischer Ausblendung aller Bedingungen – immer ein Scheitern an uns selbst. Was sich daraus lernen lässt ist Folgendes: Warum auch unter anderen (auch unter besten) Bedingungen, die gleiche Politik nicht zum gewünschten Erfolg geführt hätte. Oder materialistisch gewendet: Wie sich den gleichen, bescheidenen Umständen eine andere Politik hätte abtrotzen lassen.
Zum Weiterlesen:
Benjamin, Walter (1939): Über den Begriff der Geschichte
Traverso, Enzo (2007): Gebrauchsanleitungen für die Vergangenheit, Münster
Steffen, Michael (2002): Geschichten vom Trüffelschwein. Politik und Organisation des Kommunistischen Bundes 1971 bis 1991, Berlin u.a.O.
Trackback URL für diesen Artikel
Erschienen in arranca! #40
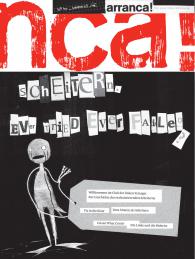

Kommentare
Kommentar hinzufügen