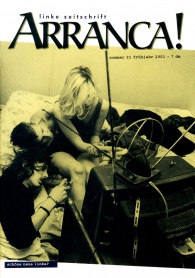Move Your Body
Zur bewegungslosen Vergewaltigungsdebatte in der Linken
Unendliche Variationen der so genannten Vergewaltigungsdebatte haben in den verschiedensten linken und linksradikalen Zusammenhängen und Organisationen während der gesamten 1990er Jahre immer wieder eine zentrale und zugleich dramatische Rolle gespielt. Entlang der meist aufreibenden, erhitzten und für alle Seiten unbefriedigenden Auseinandersetzung zum Thema sexuelle Gewalt spalteten sich ganze Gruppen, entzweiten sich befreundete GenossInnen, entstanden neue (unüberbrückbar scheinende) Fraktionierungen, politisierten sich die einen, während sich andere »aus der Politik« zurückzogen. Würde man jedoch eine Umfrage zum Thema durchführen, welches die prägenden Debatten innerhalb der radikalen Linken in den vergangenen zehn Jahren waren, kaum jemand würde die Vergewaltigungsdebatte nennen.
Das heißt, eine Debatte, die für viele Frauen und auch für einige Männer grundsätzlich die politische Perspektive verändert hat, rangiert in der Hierarchie der linksradikalen Historisierung der 1990er Jahre ganz unten. Die Diskussion war und ist ein klassisches Thema, das als »sub narrative« die Begleitmusik zu den »master narratives« der 1990er Jahre wie z.B. Nation spielt. Warum ist das Thema sexuelle Gewalt in der »Szene« einerseits ein immer wieder sich entzündender wunder Punkt, wird aber andererseits nicht als politisch prägendes Thema in der Linken wahrgenommen?
Ein Grund liegt sicherlich in der von uns so genannten neuen Privatheit der Linken. Neu deshalb, weil unserer Meinung nach diese Trennung zwischen »außerpolitischer« und »politischer« Handlung in der Geschichte der linken autonomen Bewegung schon einmal schwächer war. Hier sind auch die legitimatorischen Wurzeln des Definitionsrechtes und der identitären Debatte darum zu finden, die vielen von uns heute so seltsam starr und skurril erscheint. Diese Genese der Vergewaltigungsdiskussion ist kaum in die gemischtgeschlechtliche Linke der 1990er Jahre vermittelt worden.
Geschichte der Vergewaltigungsdebatte
Die Vergewaltigungsdebatte, wie sie heute geführt wird, hat ihre Wurzeln im Kampf der Frauenbewegung der 1970er Jahre um die Abschaffung des Paragraphen 218 und der daraus resultierenden Forderung nach dem prinzipiellen Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper. Die theoretische Grundlage für die Forderung bildete die Analyse, dass der weibliche Körper im Rahmen der patriarchalen Ordnung als Objekt betrachtet wurde: er galt als Eigentum des Mannes und wurde vom Staat – genauer gesagt von Ärzten und Richtern – kontrolliert und beherrscht. Die öffentliche Forderung nach der Selbstbestimmung über den Körper galt der damaligen feministischen Praxis zufolge als eines der wichtigsten Elemente für die weibliche Subjektkonstitution bzw. emanzipatorische Subjektivierungsprozesse und die Politisierung eines der Sphäre der Privatheit zugeordneten Themas. Die Forderung nach dem Definitionsrecht der Frau bezüglich sexueller Gewalt ist eine logische Fortsetzung der Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht über den Körper. Folge war, dass das Thema Frau-Sein politisch gefüllt, aber auch identitär bestimmt wurde. Mit dem Erbe dieser Identitätspolitik sind wir heute konfrontiert.
Die ersten Auseinandersetzungen um sexuelle Gewalt in linksradikalen Strukturen tauchten Mitte der 1980er Jahre auf. Nicht zu fällig nahm diese Debatte vor allem in autonomen Zusammenhängen den meisten Raum ein. Denn die autonome Bewegung hatte den Anspruch, das so genannte Nichtöffentliche, Private, das Persönliche als politisches Kampffeld zu definieren; im Gegensatz beispielsweise zu den so genannten Antiimps, die dazu neigten, alles, was als »persönlich« galt, dem revolutionären Kampf zur Befreiung unterdrückter Völker unter zu ordnen oder auch zu den eher parteifixierten K-Gruppen, die zwar Antisexismus als Verhaltensanweisung an ihre Mitglieder ausgaben, das Thema spielte aber in ihrer Politik lediglich eine untergeordnete Rolle.
Die aufkommende Debatte um sexuelle Gewalt in den eigenen Reihen wurde unterstützt von einer Entwicklung der Frauenbewegung der 70er Jahre hin zur Institutionalisierung feministischer Projekte wie Frauenhäuser, Beratungsstellen und Verlage, die das Thema der sexuellen Gewalt aus dem sozialen Nahbereich einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machten und auch die autonome Frauen- und Lesbenbewegung maßgeblich beeinflussten.
Ein wichtiger Meilenstein war die Erarbeitung des Definitionsrechtes. Dessen Basis war die Erkenntnis, dass die Suche nach objektiven Kriterien zur Beurteilung von sexueller Gewalt auf einem Objektivitätsbegriff basiert, der ein bürgerlich-patriarchales Phantasma ist und asymmetrische soziale Verhältnisse reproduziert, weil er die real nicht existierende prinzipielle Gleichheit aller Menschen zu Grunde legt. Die Geschichte des Definitionsrechtes der Frau ist die Geschichte der Politisierung ungleicher Geschlechterverhältnisse. Ziel war ein Machtzugeständnis an Frauen in einer ansonsten als objektiv definierten, real aber männlich oder patriarchal bestimmten symbolischen, juristischen und sozialen Ordnung. Vergewaltigung galt früher als Kavaliersdelikt und bis vor kurzem stellte die Vergewaltigung in der Ehe keinen Straftatbestand dar. Abgesehen von der Tatsache, dass man in Vergewaltigungsprozessen vor Gericht zur Pathologisierung der Vergewaltigten neigte oder versuchte, der Klägerin eine Mittäterschaft nachzuweisen, bezog sich die juristische Definition von Vergewaltigung lediglich auf die Penetration mit dem Schwanz unter Anwendung oder Androhung von Gewalt. Inzwischen ist diese enge und phallozentristische Definition auf weitere erzwungene sexuelle Handlungen erweitert worden.
Die Geschichte der staatlichen, juristischen Beschäftigung mit Vergewaltigung legitimierte vor allem in autonomen Zusammenhängen lange Zeit das absolute Definititionsrecht der Frau, wobei die normative Parteilichkeit für das Opfer die normative Parteilichkeit der bürgerlichen Rechtsprechung für den Täter ersetzte. Dadurch wurde die subjektive Wahrnehmung zur politischen Artikulation aufgewertet. Diese Identitätsbildung war wichtig für die Artikulation, Sichtbarmachung und Durchsetzung bestimmter Forderungen. Heute aber ist sie erstarrt, auf Dauer stilisiert, obwohl die Grenzen in den letzten Jahren deutlich sichtbar wurden. Der Diskurs über das Definitionsrecht »der Frau« hat dazu beigetragen, bipolare und hierarchische Geschlechtsidentitäten ebenfalls zu naturalisieren, weil Stereotypen von Männlichkeit (aktiver Täter) und Weiblichkeit (passives Opfer) reproduziert werden.
Vernachlässigte Diskussion um Sexualität
Diese Polarisierung hinterließ auch ihre Handschrift auf der immer noch heterosexuell-patriarchal bestimmten Ordnung unserer Gruppenstrukturen, unseres Habitus, und unserer Kategorisierung in persönliche und politische bzw. ineffiziente und effiziente Themen. Eine Konsequenz dessen war, dass im Gegensatz zur hoch emotionalisierten Diskussion um sexuelle Gewalt Diskussionen um Sexualität wenig vorangetrieben wurden und als politisches Feld kaum eine Rolle spielten. Ein – zugegebenermaßen unbeholfener – Versuch in diese Richtung war die Nummer 8 der Arranca! mit dem Titel »Sexualmoralischer Verdrängungszusammenhang«. Diese Ausgabe wurde vor allem deshalb kritisiert, weil sie nicht über eine heterosexuell – wenn nicht sogar männlich – geprägte Betrachtungsweise von Sexualität hinaus reichte. Trotzdem transportierte die Arranca! 8 einen wichtigen Kritikpunkt: die Tendenz autonomer Frauen- und Lesbenzusammenhänge, heterosexuelle Praktiken a priori als potentielle Gewalterfahrung für die Frau zu analysieren und unter die Gewaltdebatte zu subsumieren. Andererseits wird auch in hegemonialen Diskursen sexuelle Gewalt nach wie vor dem Bereich Sexualität und Körper und damit zumindest implizit der Privatsphäre zugeordnet, obwohl Sexualität und körperliche Gewalt zunächst zwei verschiedene Phänomene darstellen.
Dass sich diese Gleichsetzung jedoch hartnäckig durch linke und hegemoniale Betrachtungsweisen zieht, liegt an der diskursiven Funktion des Körpers als umkämpfter Ort, in den gesellschaftliche Herrschafts- und Zwangsverhältnisse wie Geschlechtsidentität eingeschrieben werden. Die allererste soziale Zuordnung, die ein Mensch erfährt, ist die des Körpers als bipolar geschlechtlich definierter Ort, als männlich oder weiblich. Den vordiskursiven Körper gibt es somit nicht. Auf dem Feld »Körper« wird auch Sexualität und Gewalt ausgetragen. In beiden Fällen wird um die Grenzen des Körpers gerungen, im ersten Fall spielerisch, im zweiten Fall unter Zwang.
Körper als Kampffeld
In den meisten nationalen Mythologien ist der geschlechtlich definierte Körper eine sexualisierte Metapher für die Nation, als Ort der Eroberung, der Unterwerfung und des Kampfes gegen andere Nationen-Körper. In diesen nationalen Mythologien werden dem männlichen und dem weiblichen Körper unterschiedliche Funktionen zugeschrieben. Der männliche Körper steht in dieser nationalen Symbolik für Stärke und Eroberung, der weibliche dient als Metapher für den Ort der Reproduktion des Nationen-Volkes oder aber für den zu unterwerfenden, zu erobernden Ort. Systematische Vergewaltigungen von Frauen des Feindes im Krieg sollen dessen Demütigung, Unterwerfung und Zerstörung markieren. Im Militär werden neue oder schwache Soldaten häufig von ihren Vorgesetzten in sexualisierten, gewalttätigen Rituaelen gedemütigt. Setzen sie sich nicht erfolgreich zur Wehr, bezeichnet man sie danach als Frauen oder Schwule.
Dies zeigt, dass Vergewaltigung weder an einen anatomischen weiblichen Körper gebunden ist, noch dass sexuelle Gewalt mit »anders nicht auslebbaren« bzw. »gesellschaftlich unterdrückten sexuellen Trieben« zu rechtfertigen ist. Sexuelle Gewalt dient der Herstellung und Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen, die auf dem sozialen Feld des Körpers ausgetragen werden. Diese Herrschaftsverhältnisse basieren auf einer heterosexuellen, phallozentrischen gesellschaftlichen Matrix, in der das Weibliche als Mangel konzipiert ist. Die symbolische Ordnung der Geschlechter wird von Männern und Frauen – siehe Klitorisbeschneidung oder die medizinischen Vereindeutigung von Intersexuellen – permanent und häufig gewaltförmig reproduziert. Die These, dass einer Vergewaltigung meist primär nicht ein Bedürfnis nach Sexualität zugrunde liegt, bestätigt auch Georg Klauda in seinem Artikel »Genosse Vergewaltiger - Feministinnen im Visier der Linken« (Gigi, 9/10/2000). Klauda bezieht sich auf eine empirische Studie von Wolfgang Kröhn 1968 anhand von knapp 150 polizeibekannten Vergewaltigern, die zu dem Schluss kommt, dass nur bei 20 Prozent der Täter unter anderem sexuelle Kontaktstörungen für die Tat eine Rolle spielten. Bei weiteren 30 Prozent der Vergewaltigern liegen »kaum sexuelle Motive zugrunde«, sondern »Dominanzkonflikte und Insuffizienzgefühle in der eigenen Männlichkeitsrolle« (ebd). Die größte Gruppe (etwa 50 Prozent) besteht aus Tätern, »die in der unvermittelten sexuellen Attacke auf das andere Geschlecht ihre offen frauenfeindliche, verobjektivierenende und abschätzige Haltung zum Ausdruck bringen (...) Ihre Beziehungen zum anderen Geschlecht sind von Desinteresse und wenig Zärtlichkeit bestimmt, sie selbst weisen schlechte Ich-Kontrollen und geringe Frustrationstoleranz auf.«
Körper als Spielfeld
Auch bei Sexualität geht es um Macht, allerdings verstanden als Bestimmung über Prozesse und Selbstbestimmung über Ressourcen. Im Gegensatz zur sexuellen Gewalt ist Sexualität ein Spiel mit Machtpositionen, das auf einer Übereinkunft basiert, in dem es um das ausgehandelte Austesten, Aufgeben oder Überschreiten von Körpergrenzen geht, die in anderen Formen sozialer Beziehungen nicht angetastet werden. Die verbale Ebene der Kommunikation kann verlassen und durch eine körperliche Ebene der Verständigung ersetzt oder ergänzt werden. Diese Übereinkunft kann auch beinhalten, dass eine Person den unterwerfenden, die andere den erobernden Part übernimmt – die Beteiligten also bestimmte Rollen spielen. Der entscheidende Unterschied zur sexuellen Gewalt, die auf Zwang basiert, besteht im zuvor vereinbarten »Spiel« mit sexuellen Positionen – auch wenn sie dem »heterosexuellen Mainstream« entsprechen. Sexuelle Rollen werden verhandelt, verteilt und eingenommen. Ganz anders als im Fall von sexueller Gewalt geht es aber nicht darum, unter Zwang herrschaftsförmige sexuelle Hierarchien zu reproduzieren, weil sie als »natürlich« gelten.
Neue Privatheit - alte Muster
Vergewaltigungsdebatten in der »Szene« werden meist durch einen konkreten Vorfall im jeweiligen politischen Umfeld ausgelöst und in der Folge zunächst – dem Denken der Unterscheidung von Privatleben und öffentlichem Leben folgend – »gruppenintern« verhandelt. Als privat wird hierbei die eigene Gruppe, als öffentlich die so genannte Szene definiert. Hier greift der Trend der Linken wieder, zunehmend zwischen dem »individuellen« Privatleben (Beziehungen, Lifestyle, aber auch mehr und mehr die persönlichen Arbeitsverhältnisse) und »öffentlicher« politischer Betätigung in Diskussions- und Aktionszusammenhängen zu trennen. Geht es um sexuelle Gewalt in den eigenen Reihen – so unsere These – bricht dieser Widerspruch auf, da plötzlich und oft ziemlich massiv eine Positionierung der »politischen Öffentlichkeit« zum selbst ernannten »Privatleben« gefordert wird, meist seitens der/des von sexueller Gewalt Betroffenen oder noch eher seitens des engsten Umfeldes. Dass der Widerspruch zwischen neuer Privatheit und politischer Öffentlichkeit dort aufbricht, wo sexuelle Gewalt zum Thema werden soll, liegt unserer Meinung nach daran, dass feministische Aspekte in der autonomen Bewegung schon immer eher auf Akzeptanz gestoßen sind als beispielsweise antikapitalistische Analysen. Deshalb entzünden sich innerhalb postautonomer Zusammenhänge auch keine emotional geführten Debatten entlang ungleicher ökonomischer Bedingungen der Gruppenmitglieder – aber das nur am Rande.
Die auf den Vorfall der sexuellen Gewalt folgende – in der ersten Phase gruppeninterne – Auseinandersetzung verläuft meist nach kurzer Zeit über die betroffenen Personen hinweg auf einen Grabenkampf zwischen mehreren sich bildenden Fraktionen hinaus und nach einem der folgenden Muster ab:
- Die von sexueller Gewalt betroffene Person (meist eine Frau) wird pathologisiert oder psychiatrisiert, man gibt ihr, zumindest latent, eine Mitschuld an dem Vorfall oder aber ihr Umfeld schreibt sie als gesamte Person »für immer« auf den Opferstatus fest.
- »Der Täter« (zumeist ein Mann) wird – eher durch Ignoranz des sekundären Umfelds als durch aktive Parteinahme – von einer Fraktion geschützt oder aber für immer aus dem jeweiligen politischen Umfeld ausgeschlossen, was dem »Verstoßungsritual« traditioneller Dorfgemeinschaften gleichkommt und strukturell vormoderne Züge trägt. Auch er bleibt damit für immer »der Täter«.
- Die Frauen der Gruppe fühlen sich plötzlich alle irgendwie als potentielle Opfer, alle Männer als potentielle Täter, man grenzt sich ab oder ist froh, ein »Bauernopfer« erbracht zu haben.
- Schließlich stellt man zum wiederholten Male das Definitionsrecht der Frau in Frage und ringt – noch tiefer in bürgerliche Rechtsstaatsgläubigkeit versinkend – nach der Findung »objektiver« Kriterien zur Prüfung des Wahrheitsgehalts der Aussage der Anklägerin bzw. ihrer Verteidigung.
Antisexistische Perspektiven
Das große Dilemma aller Vergewaltigungsdebatten in der Linken besteht darin, dass stoisch wiederkehrend, mit dem Argument objektive Kriterien finden zu müssen, das Definitionsrecht der Frau grundsätzlich in Frage gestellt wird, weil man es mit einem Sanktionsrecht bzw. mit einem standardisierten Katalog an Sanktionen und Umgehensweisen gleichsetzt (»Vergewaltiger und Täterschützer raus aus allen unseren Zusammenhängen«). Diese Sanktionen und Umgehensweisen tragen den Charakter interner Säuberungen und müssen neu diskutiert werden, wenn in Zukunft eine konstruktivere Praxis gegen sexuelle Gewalt in den eigenen Reihen entwickelt werden soll. Denn mit der Forderung nach dem »Vergewaltiger raus aus allen unseren Zusammenhängen« wird erstens ein höchst zweifelhaftes »Wir« konstruiert, das die Vorstellung transportiert, man könne den eigenen Zusammenhang allein durch drakonische Maßnahmen von den »schädlichen« gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen »draußen« reinhalten. Zum zweiten entledigt man sich real nur vermeintlich eines Problems, indem man es an eine sich außerhalb der Szene befindliche Gesellschaft geradezu erleichtert übergibt.
Bei der Entwicklung eines anderen Umgehens mit sexueller Gewalt muss jedoch nicht das prinzipielle Definitionsrecht berührt werden, wenn es als Parteilichkeit für die von sexueller Gewalt betroffene Person definiert wird, der eben nicht zwingend die standardisierten Sanktionen folgen.
Die Diskussion um die politischen und sozialen Konsequenzen der Artikulation des Definitionsrechtes sollte in Zukunft vielmehr stärker kollektiv geführt werden. Das bedeutet, ein von der betroffenen Person gewähltes Umfeld muss die politische Verantwortung für ein praktisches Umgehen mit dem Definitionsrecht wahrnehmen und von Einzelfall zu Einzelfall garantieren. Die szeneüblichen Verallgemeinerungen und Formalisierungen bezüglich sexueller Gewalt sind sowieso nicht standardisiert anzuwenden – das wissen alle, die schon einmal »näher« an einer solchen Auseinandersetzung dran waren. Sexuelle Gewalt ist ein systematischer Angriff auf die persönliche Integrität, trotzdem kommt es auf die Biographie, emotionale Verfasstheit und vor allem auf das Umfeld der jeweiligen Frau an, wie sie eine Vergewaltigung verarbeitet, und ob bzw. welche psychischen Schäden eine Vergewaltigung hinterlässt. Die Stilisierung der Vergewaltigung zum Schlimmsten, was einer Frau passieren kann, einerseits und die Tabuisierung von sexueller Gewalt als gesellschaftlicher Alltag andererseits bewirken häufig erst den Kreislauf von Scham, Schuld und Viktimisierung. Zudem ist die Annahme, dass die betroffene Frau sich allein über eine Vergewaltigung klar wird und den Vorwurf dann ebenso im Alleingang vorbringt, generell ein Trugschluss. Dem öffentlich artikulierten Vorwurf, vergewaltigt worden zu sein, geht meist ein längerer Prozess an Gesprächen und emotionalen sowie gedanklichen Klärungsprozessen mit vertrauten Personen voraus. Was bei den meisten Debatten nicht thematisiert wird, sind die Ansprüche an eine kollektive präventive Praxis, die eben keine Feuerwehrpolitik ist. Denn eigentlich sollte das Definitionsrecht am Ende einer ansonsten missglückten antisexistischen Politik stehen. Sexuelle Gewalt ist kein Ausrutscher, keine Einzeltat eines Gestörten, sondern ein alltägliches gesellschaftliches Phänomen, das ganz banal die sexualisierten Herrschaftsverhältnisse spiegelt. Deshalb ist eine größer angelegte, gruppenübergreifende, öffentliche politische Auseinandersetzung um den Unterschied zwischen Sexualität und sexueller Gewalt, um (auch in der Szene gültige) traditionelle Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit sowie um Geschlechtsidentität, vor allem mit jungen anpolitisierten Leuten nötig. Aus diesem Grund ist auch die Auseinandersetzung mit den »Tätern« nötig. Insbesondere junge Antifas sehen beispielsweise den Hooliganism von jungsclubartig auftretenden postpubertierenden Mackern als elementaren Teil einer linksradikalen politischer Identität.
Eine langfristige, antisexistische Praxis muss deshalb zuerst die strukturelle heterosexuelle Verfasstheit unserer eigenen Arbeitsformen, Politikinhalte und die Trennung zwischen öffentlich-politischem und privat-individuellem Leben, die mittlerweile unabhängig vom Geschlecht von den meisten mitgetragen werden, wieder wahrnehmen. Damit ist zum einen die Benennung struktureller Gewaltverhältnisse entlang der Kategorie Geschlecht in der alltäglichen politischen Praxis (einschließlich der eigenen Strukturen) gemeint – und nicht nur, wenn es brennt. Vielmehr aber muss in Zukunft das eigene bipolare, heterosexuelle und identitäre Denken kritisch betrachtet und verändert werden. Opfer zu sein ist ein beseitigungswürdiger Zustand, aber keine politische Kategorie, in der das Subjekt aus dem Diskurs verschwindet. So könnte das Thema Geschlechterverhältnisse, das der Diskussion um die sogenannte Vergewaltigungsdebatte zu Grunde liegt, als eine asymmetrische Machtstruktur, die nicht zwangsläufig an das anatomische Geschlecht gebunden ist, wieder an Bedeutung gewinnen und für Linke zu einem Politikinhalt werden.
Trackback URL für diesen Artikel
Erschienen in arranca! #21