Sieben Fragen zum Organisierungsprozess
Folgender Text entstand 1993 im Zusammenhang mit der Organisationsdiskussion. Nach unserer Einladung in der Arranca Nr.0 („Treffen für eine radikale, linke Organisation”) trafen sich Pfingsten 1993 zehn Gruppen in Berlin. Bei diesem ersten, schwierigen und sehr zähen Wochenende verabredeten wir, zu acht gemeinsam formulierten, grundsätzlichen Fragen bis zum nächsten Treffen im September '93 Texte zu verfassen.
Dies sollte einerseits zur inhaltlichen Klärung dienen; über die Beiträge sollten sich die verschiedenen Gruppen besser kennenlernen. Zum anderen waren diese Papiere als Grundlage für einen zu veröffentlichenden allgemeinen Konsens (eine Art reduzierter Organisationsplattform) gedacht. Die Diskussion über die unterschiedlichen Papiere (inzwischen über anders formulierte Fragen) dauerte jedoch endlos an. Die inhaltlichen Widersprüche waren gewaltig. Immer mehr rückte der Wunsch in den Mittelpunkt, ein Programm zu verabschieden und so eine Organisation zu gründen. Inhaltliche Übereinstimmung alleine kann jedoch niemals Grundlage einer linken Organisation sein, wenn nicht gleichzeitig gemeinsam praktische Erfahrungen gesammelt werden. Unser Versuch hat das noch einmal ganz deutlich gezeigt. Ohne die Auseinandersetzung am Konkreten passiert das unerwünschte: die Struktur wird zum Wasserkopf, das Programm ersetzt den realen Werdungsprozeß in der Praxis.
Es ist sicherlich ungünstig, nach fast einem Jahr einen Text zur Organisationsdiskussion zu veröffentlichen, wenn wir selbst diesem Ansatz, für den der Text verfaßt wurde, nicht mehr angehören. Wir wollten schon im September '93 die folgenden sieben Fragen veröffentlichen, wir haben jedoch immer auf eine gemeinsame Veröffentlichung gewartet, die jedoch aufgrund der Meinungsverschiedenheiten nicht zustande kam. Dennoch halten wir die Veröffentlichung des folgenden Textes für sinnvoll. Die dargestellten, leicht überarbeiteten Punkte sind für uns weiterhin Grundlagen im Organisationsprozeß, d.h. Kriterien dafür, wie wir uns das Aussehen einer linken Organisation und ihre Politik mittelfristig ungefähr vorstellen. Da wir weiterhin am Entstehen einer solchen Organisation arbeiten, ist der Text weiterhin als gültiger Diskussionsvorschlag zu sehen.
1. Welche politischen Strategien halten wir für sinnvoll? Wie können gesellschaftliche Zustände schon heute unter den bestehenden Verhältnissen verändert werden?
„Machtübernahme”
In der Arranca Nr. 0 haben wir uns in den „38 Thesen” von leninistischen Revolutionsstrategien kritisch abgegrenzt. Wir vertraten die Ansicht, daß bei diesen Strategien - die nicht nur von den kommunistischen Parteien, sondern auch von den meisten „neulinken“ Gruppen verfolgt wurden - „Revolution auf politische Machtübernahme und Verstaatlichung des Privateigentums beschränkt werde.“ Es hieß außerdem: „ (...) hat der Revolutionsbegriff der KPdSU (und damit auch späterer kommunistischer Parteien, z.B. PC Cubas) mit einer wirklichen gesellschaftlichen Umwälzung nur vordergründig zu tun. Die Regierungsübernahme als solche stellt die Verhältnisse nicht in Frage. Revolution ist ein breiter, subjektiv erfahrbarer Prozeß der radikalen Veränderung aller Lebenssphären, nicht nur die Absetzung der Regierung und die Vergesellschaftung von Eigentum. Revolution ist ein langwieriger Prozeß ohne klaren Anfang und Ende.“
Die Folgerung war, daß Machtübernahme zwar ein „notwendiger, aber nicht hinreichender“ Bestandteil eines revolutionären Prozesses sei.
„Determinismus“
Zum zweiten stellten wir uns gegen die deterministische Tradition in der Linken, nach der die Geschichte sozusagen vorherbestimmt sei. Die verschiedenen Gesellschaftsformationen (Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus) lösen sich in diesem Weltbild mechanisch ab, die Entwicklung der Produktivkräfte führt automatisch zur jeweils höheren Stufe und die Menschen sind nur Vollzugsorgane der fest- geschriebenen Geschichte. Der Determinismus war kein Steckenpferd des Sowjetmarxismus, er wurde von den unterschiedlichsten Strömungen der Linken verfolgt: die Sozialdemokratie vertrat ihn und rechtfertigte damit ihre Strategie des allmählichen „Hinüberwachsens in den Sozialismus“; die Spontis und Rätekommunistinnen erwarteten, daß die Arbeiterräte von selbst den Sozialismus einführen würden (der vom Kapital geschaffene Widerspruch -das Proletariat- hebt jenes auf); und die Leninistinnen schließlich begründeten mit der Determiniertheit der Geschichte ihre Rolle als Avantgarde: die Geschichte folge einer Wahrheit, die Wahrheit könne wissenschaftlich herausgefunden und schließlich von der Avantgarde, den organisierten Kommunistinnen, umgesetzt werden. Alle drei Ausprägungen des Determinismus haben also unserer Meinung nach die gleiche Wurzel, von allen drei halten wir wenig.
Die Folgerungen hieraus für unsere politische Strategie sind:
In unserem Konzept von Organisation soll es nicht nur um die Frage der politischen Macht, sondern muß es schon jetzt auch um die anderen Felder notwendiger Umwälzung gehen. Solche Ziele. die von leninistischen Parteien kaum bzw. instrumentell verfolgt wurden, sind z.B.: eine gleichberechtigte Umgangsform untereinander, das Entstehen einer solidarischen Alltagskultur, Institutionen der Selbstregierung, Zerschlagen patriarchaler Unterdrückung, Aufbrechen hierarchischer Arbeitsteilun-gen usw.
Insgesamt beinhaltet eine solche Strategie der Umwälzung mehr als nur eine frontale Auseinandersetzung mit einem klar lokalisierbaren Feind. Unterdrückung hat nicht nur ein Zentrum und eine Wurzel. Deswegen ist die allmähliche, unscheinbare Eroberung von Stellungen in der Gesellschaft für eine Gegenmacht von unten ähnlich wichtig wie die spektakuläre Konfrontation mit der Polizei oder staatlichen Behörden. Zu einer allmählichen Eroberung von Stellungen, zu einem Entstehen von revolutionärer Gegenmacht gehört es, daß wir als Linke in Kulturzentren, Schulen, Betrieben, Stadtteilen nicht nur „hineinwirken”, sondern wirklich darin arbeiten.
Damit dies nicht zum Aufsaugen in den Institutionen wird (der Marsch der 68er durch die Institutionen hat viele der 68er erledigt, nicht das System) ist eine stärkere, organisatorische Bindung der aktiven Personen notwendig. Die von uns angestrebte politische Organisation ist nur ein Teil dieser Bindung. Auch kulturelle und soziale Bewegungen, Zeitungen, Diskussionsforen, der Zusammenhalt in Stadtteilen, Freundschaften usw. können gewährleisten, daß die Grenzen zwischen der Antifa-Arbeit, den fortschrittlichen Lehrerinnen, militanten Aktionen, Frauengruppen, Immigrantinnen-Initiativen usw. fließender werden. Umso weniger jemand vereinzelt in Institutionen herumwurstelt, umso schwerer wird er vom System integriert. Die Voraussetzung für ein Festsetzen im Alltag, das nicht im Reformismus endet, ist also Organisiertheit und Beteiligung an politischen Kämpfen. Weder macht es großartig Sinn, zu Kampagnen immer wieder Tausende auf die Straße zu bringen, ohne dabei real verankert zu sein, noch bietet es eine Perspektive, wenn linke Einzelpersonen (z.B. in einem Kulturprojekt) gut verankert sind, sich aber an politischen Konflikten nicht beteiligen.
Unser Selbstverständnis einer politischen Organisation ist nicht das einer Avantgarde. Es gibt keinen vorhergeschriebenen Weg zur Befreiung, schon gar keine „Vernunft in der Geschichte“, auf die wir uns berufen könnten. Verschiedene Wege sind denkbar, unterschiedliche Ansätze - egal ob politische Gruppe /Organisationen, soziale Bewegungen oder lokale Initiativen- müssen mit Respekt behandelt werden. Es ist falsch, ihnen den eigenen Stempel aufdrücken zu wollen.
Andererseits ist es allerdings unverzichtbar, nicht darauf zu warten, daß sich Widersprüche „von selbst“ lösen. Wir erwarten von einer politischen Organisation, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, Prozesse zu dynamisieren und als Orientierungspunkt für die zahlreichen, verstreuten Initiativen zu dienen. Sie muß natürlich Alternativen zum Bestehenden aufzeigen und versucht damit, Richtungen vorzugeben.
Strategisch bedeutet für die von uns angestrebte Organisation:
- andere Kampfformen sind anzuerkennen;
- ein Blick über die politische Linke hinaus ist zu entwickeln: zahlreiche Projekte, die verächtlich als „sozialarbeiterisch“ diffamiert oder ganz ignoriert werden, haben das Potential, Teil gesell-schaftlicher Gegenmacht zu werden. Wir müssen uns um mehr Austausch mit diesen Menschen und Projekten bemühen
- an möglichst viele derjenigen, die diffus und vereinzelt emanzipatorisch/links tätig sind, haben wir Angebote zur Mitarbeit bei konkreten Fragen oder zur Organisierung zu formulieren. Unsere Projekte müssen immer wieder so offen sein, daß man von unterschiedlichen Bereichen heraus daran „andocken“ und mitmachen kann
- diese Angebote dürfen weder so wirken noch sein wie bei den Vorfeldorganisationen marxistisch-leninistischer Parteien: dort werden offene Angebote, z.B. ein Bündnis gegen Faschismus, aufgebaut, wobei es für die politische Partei nur darum geht, sich selbst personell und politisch zu stärken. Ein Bündnis, in dem man sich die Avantgarde-/ Führungsrolle selbst vorbehält, ist kein Bündnis!
„Reformen“
In diesem Sinne sind wir für Veränderungen im bestehenden System, wenn sie Kampfbedingungen oder die Lebensverhältnisse real (z.B. Gesundheit am Arbeitsplatz oder Situation in den Knästen) verbessern. Anders als wir es vor einem Jahr formuliert haben, ist der Begriff „Reformen“, unter dem wir staatlich institutionalisierte Veränderungen im Rahmen von Gesetzen usw. begreifen, dabei allerdings ausgesprochen unpassend. Zwar ist es richtig - wie wir damals vertreten haben -, daß Reformen sehr oft einen ambivalenten Charakter haben, d.h. sie stellen einen Kompromiß zwischen den emanzipatorischen Forderungen von unten und den Modernisierungszwängen von oben dar. (Die ganze Reformwelle als Reaktion auf die 68er-Bewegung trägt dieses Doppelgesicht: z.B. die Bildungsreform brachte sowohl eine Befreiung der Lernenden mit sich wie ihre Individualisierung in den Massenuniversitäten). Andererseits ist es jedoch wenig realitätsnah, heute von Reformmöglichkeiten zu reden. Angesichts schwacher emanzipatorischer Bewegungen von unten und einem hohen Modernisierungsbedürfnis der kapitalistischen Gesellschaft, stellen sich die „rot-grünen“ Reformprojekte als ebenso düstere Visionen dar wie die konservative Wirklichkeit. Es geht im Augenblick nur um Aspekte kapitalistischer Erneuerung. Auch im „rot-grünen“ Projekt ist beispielsweise Zwangsarbeit für das ökologische Gemeinwohl mit vorgesehen.
„Veränderungen im Bestehenden“ sind daher heute nicht große politische Reformen, sondern die Durchsetzung von konkreten Zielen. Dazu gehört die staatliche Finanzierung eines Zentrums genauso wie die Verhinderung von Olympia in Berlin oder Obdachlosenzeitungen, durch die sich Leute selber finanzieren und politisch artikulieren können.
Linksradikale Politik sollte sich stärker daran ausrichten, was - angesichts der Kräfteverhältnisse - realistischerweise durchsetzbar ist. (Bei aller ursprünglichen Kritik unsererseits hat sich die Berliner Olympia-Kampagne als strategisch bestimmte Einmischung erwiesen). Errungene Erfolge müssen danach auch unbedingt als eigene dargestellt werden. Nur dadurch entsteht nämlich das Bewußtsein eigener Stärke.
Arbeitsfelder, Teilbereiche
Die Arbeitsfelder oder Teilbereiche können nicht beliebig gewählt werden. Es ist keineswegs eine politische Entscheidung, jetzt einmal Soli-Arbeit zum Land X zu machen, weil „es da bisher so wenig gibt“. Die Bestimmung von Arbeitsschwerpunkten muß sich unserer Ansicht nach vor allem daran orientieren, was a) analytisch als zentraler Brennpunkt erkannt wird, b) im Rahmen unserer Möglichkeiten ist und c) einen Organisationsprozeß vorantreiben kann. So haben wir lange Zeit davon geredet, zu verschiedenen Themen zu arbeiten bzw. die soziale Frage stärker aufzugreifen. Beides konnten wir inhaltlich begründen (linke Politik muß gesamtgesellschaftlich sein/die soziale Frage ist der brennendste Punkt für fast alle hier lebenden Menschen).
Unsere Erfahrung ist jedoch, daß eine nicht sehr große Gruppe sich auf einen oder zwei Arbeitsschwerpunkte beschränken muß. Diese müssen so geartet sein, daß die Gruppe darüber politisches Profil gewinnen kann. Nur durch solche Umsetzung werden politische Entwürfe glaubwürdig. Für uns, die wir die Antifaschistische Aktion-bundesweite Organisation im Moment für den erfolgversprechendsten Organisationsansatz in der undogmatischen radikalen Linken halten, liegt nahe, daß Antifa ein solcher Arbeitsschwerpunkt ist. Wichtig ist dabei, immer wieder über den Teilbereich hinauszugehen und sich zu anderen Themen zu Wort zu melden. Nur dadurch kann es gelingen, vom Konkreten zum Allgemeinen zu kommen. Die Gruppen der angestrebten Organisation können nicht dabei stehen bleiben, Nazis anzugreifen oder Kampagnen zu machen, ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt zu thematisieren. Ansonsten droht Teilbereichsarbeit zur Sackgasse zu werden.
2.) Welche Zielsetzungen werden von der (angestrebeten) Organisation verfolgt? Welche Strukturen besitzt sie? Wie kann die Herausbildung von Hierachien so weit wie möglich verhindert werden? (als Stichpunkte tauchten in diesem Zusammenhang auf: „Leitung“?, „Kader?“, Rotation, Delegation, SprecherInnenprinzip)
Kollektive Schule
Wir streben eine politische Organisation unter anderem an, um
a) wieder in der Öffentlichkeit wahrnehmbar zu sein, b) arbeitsteilig intervenieren zu können, c) überregional und koordiniert zu handeln und d) ein klar umrissenes politisches Angebot zur Mitarbeit darzustellen.
Genauso wichtig wie diese vier Punkte erscheint uns jedoch, daß die angestrebte Organisation als eine Art kollektive Schule begriffen wird, in der sich Verbindlichkeit, soziale Verantwortung, Solidarität, emanzipatorische Verhaltensformen und Bewußtsein entwickeln. Effizienz ist für uns nicht das einzig entscheidende Kriterium, eine Organisation ist mehr als ein Kampfinstrument. Insofern unterscheiden wir uns wesentlich von Parteikonzepten leninistischer Tradition. Wir sind der Meinung, daß Befreiung in einer revolutionären Organisation stückchenweise vorweggenommen werden muß. Die notwendige Kultur sozialer und politischer Emanzipation, also z.B. das veränderte Alltagsverhalten, muß von der Organisation ausstrahlen. Sie muß zumindest ansatzweise darstellen können, wie eine befreite Gesell-schaft funktionieren könnte.
Allgemein befürworten wir eine offene, politische Organisation, die innerhalb klar umrissener Grenzen Spielraum für Selbständigkeit und Eigeninitiativen vor Ort bietet. Die angestrebte Organisationkann und soll nicht immer völlig einheitlich handeln, weil die Bedingungen regional unterschiedlich sind. Wir wollen auch keine Mitgliederorganisation, in der Karteileichen scheinbare Größe vortäuschen, sondern eine Organisation, die sich über Mitarbeit definiert.
Dies bedeutet, daß handlungsfähige, arbeitsteilig funktionierende, verankerte und verbindlich organisierte Gruppen vor Ort das eigentliche Hauptgewicht einer Organisation tragen müssen.
Im Gegensatz zu unserer Einschätzung vor einem Jahr sind wir inzwischen der Meinung, daß das Entstehen solcher Gruppen wichtiger für den Organisationsprozeß ist als der Aufbau bundes-weiter Strukturen. Es ist gegenüber einer zunehmend individualisierten Szenelinken immer wieder zu betonen, daß organisierte Gruppen überhaupt erst die Voraussetzung sind für jeden sozialen Prozeß, jede längerfristige politische Initiative und jede ernsthafte Diskussion. Dies ist zwar noch keine Garantie für den Erfolg, aber unbedingt notwendig. Wer sich also nicht in einer verbindlichen Gruppe langfristig organisiert, braucht über bundesweite Strukturen nicht zu diskutieren!
Dennoch bleibt für uns die Arbeit in einer bundesweiten Organisation auch für den Entwicklungsprozeß vor Ort notwendig.
Verbindliche Grundlage der Organisation sind gewachsene Strukturen und Arbeitsmethoden, in der Praxis gesammelte und reflektierte Erfahrungen und eine Plattform, die aus inhaltlichen Diskussionen heraus allmählich entsteht. Getroffene, gemeinsame Beschlüsse müssen bindenden Charakter besitzen. Ansonsten kann keine gemeinsame Kraft sichtbar werden. D.h. falls Delegierte gemeinsam Positionen verabschieden und Aktivitäten ausmachen (und nicht unmittelbar danach von den Gruppen vor Ort Bedenken dagegen geäußert werden), haben auch alle Gruppen diese Linie nach außen zu vertreten. Mindestens so weit muß gegenseitige Verbindlichkeit schon reichen.
Leitung?
Bei einer Größe von Organisationsansätzen, wie sie heute bestehen, ist jede „Leitung“ überflüssig und politisch falsch. Strukturen müssen immer auf der Grundlage von Notwendigkeiten wachsen. Es ist unsinnig und bürokratisch, über zentralisierende Gremien nachzudenken, wenn die gemeinsame politische Praxis dies noch nicht erforderlich macht.
Langfristig halten wir allerdings für eine Organisation die Einrichtung eines zentralen Büros für sinnvoll, das die Aufgabe hätte, die Arbeit der Gruppen zu koordinieren und als Pressestelle zu fungieren. Die dort Arbeitenden wären Sprecherinnen der Organisation, und damit dazu bevollmächtigt, in der Öffentlichkeit selbständig und aktuell Stellung zu beziehen.
Weisungsbefugnisse von zentralen „Einrichtungen“ lehnen wir auch langfristig ab. Politische Initiativen werden zwar zwangsläufig auch immer wieder von denen ausgehen, die koordinierende, zentrale Funktionen innehaben, aber es ist notwendig, dem entgegenzuwirken. Rotation ist ein wichtiges Prinzip auf allen Ebenen. Wir sind außerdem dafür, daß v.a. Gruppendiskussionen vor Ort immer wieder zu neuen überregionalen Anstößen führen.
„Kader“?
In jeder Gruppe und noch mehr in bundesweiten Strukturen ist es nicht zu verhindern, daß einzelne aus Zeitgründen, Überzeugung, Lebenswirklichkeit oder Interesse intensiver arbeiten und mehr Einfluß haben als andere. Ihre Stimme hat in der Regel mehr Gewicht in Dis-kussionen, Initiativen gehen öfter von ihnen aus, eine Gruppe orientiert sich an ihnen. Eine völlige Gleichheit in Gruppen und Strukturen wird nie zu erreichen sein.
Solche Menschen könnte man unserer Meinung nach als „KaderInnen“ bezeichnen. Wir halten es allerdings für verhängnisvoll, wenn diese Stellungen veramtlicht werden, indem die Leute „Leitungskader“ oder „Ortsvorsitzende“ werden. Wesentlich für die Lernprozesse in einer Organisation ist es, daß VerantwortungsträgerInnen immer wieder aus ihren Funktionen herausgedrängt werden können. Dies bedeutet nicht, sie aus der Gruppe zu werfen. Wir meinen vielmehr, daß Lernprozesse sehr oft konfliktiv verlaufen. Um sich von Autoritätsmustern zu befreien, muß man auch in einer gewissen Art „rebellieren“ können. Solche Konflikte über Autoritätsstrukturen in Gruppen bedeuten nicht ihr Ende, sondern sind Grundlage für die Emanzi-pation innerhalb von Organisationen. Hierarchien sind gezielt abzubauen. Durch das Übernehmen von Aufgaben, durch praktische Erfahrungen und das Vermitteln von Wissen müssen möglichst alle Beteiligten selbst zu Verantwortungsträgerinnen werden. (Darüber steht auch einiges in der arranca! Nr.1).
Rotation und Delegation
Rotation halten wir für richtig, um hierarchische Arbeitsteilungen abzubauen. Zwar muß nicht jede/r alles können und es muß auch geschlossene Gruppen (z.B im Zusammenhang mit der Repression) geben, aber ansonsten finden wir es sinnvoll, daß jede/r unterschiedlichste Aufgaben schon einmal übernommen hat. Niemals darf es dazu kommen, daß in einer linken Organisation die einen Flugblätter schreiben, die die anderen verteilen. Deutlich ist uns im letzten Jahr allerdings auch geworden, daß Rotation einen sehr viel höheren Kraftaufwand bedeutet, denn immer wieder müssen Erfahrungen weitergegeben werden. Ergänzend dazu halten wir das Delegationsprinzip natürlich für sinnvoll, wenn dadurch ermöglicht wird, Arbeit in einem kleineren Rahmen angenehmer und effektiver zu gestalten. Das Zurücktragen in größere Zusammenhänge ist aber notwendig, um eine Verselbständigung zu verhindern.
3.) Wie könnte der Herausbildungsprozess der Organisation aussehen?
Einen Mittelweg
Der Herausbildungsprozeß einer Organisation muß einen Mittelweg zwischen zwei Extremen finden:
- weder ist eine schematische, abgehobene Gründung durch Verabschiedung einer Plattform und die Festschreibung von Strukturen und Statut vom grünen Tisch aus möglich,
- noch können wir wir einfach darauf warten, daß irgendwelche revolutionären Zusammenhänge organisch zusammenwachsen. Das Entstehen von Gruppen vor Ort und von bundesweiten Strukturen muß bewußt forciert werden. In diesem Sinne halten wir das Konzept der allmählichen Vernetzung für das Entstehen einer Organisation für untauglich.
Wir glauben nach einem Jahr ILO-Ansatz nicht mehr, daß ein solcher Herausbildungsprozeß vorrangig durch bundesweite Diskussionen vorangetrieben werden kann. Kern des Organisationsprozesses muß die regionale Verankerung von Gruppen vor Ort sein. Ihre politische Praxis muß immer wieder in bundesweiten Initiativen münden. Durch solche gemeinsamen Erfahrungen, z.B. eine Kampagne gegen die FAP oder eine bundesweite Antikriminalisierungsdemonstration, werden Diskussionen möglich. Diese sind politisch verankert, d.h. es handelt sich um Praxis gewordene theoretische Überlegungen . Inhaltliche Auseinandersetzungen zu grundsätzlichen Fragen sind Bestandteil des Organisationsprozesses, aber wir glauben nicht mehr, daß sie Ausgangspunkt sein können. In der Antifaschistischen Aktion-BO ist dies durchaus positiv gelöst: Neben der Auseinander-setzung um die konkrete, z.T. regional unterschiedliche Praxis und Bemühungen um bundesweite Kampagnen gibt es zu jedem Arbeitstreffen theoretische Auseinandersetzungen anhand eines Thesenpapiers, das sowohl in den Gruppen vor Ort als auch bei den bundesweiten Delegiertentreffen diskutiert wird.
4.) Wie sieht die Darstellung unserer eigenen Arbeit in der Öffentlichkeit aus? Welches Verhältnis besitzen wir zu den regionalen und überregionalen Massenmedien?
(Im Schwerpunkt der Arranca Nr.2 haben wir ausführlich dargelegt, warum wir eine Medienarbeit auch in bürgerlichen Medien für unbedingt notwendig halten. Darauf wollen wir hier nur kurz verweisen.)
5.) Wie ist das Verhältnis unseres Organisationsansatzes zu Frauen- und ImmigrantInnen-Gruppen?
Spezifische Organisierung
Im Verhältnis zu Frauen- und Immigrantlnnengruppen reicht es nicht aus, Offenheit zu betonen. Es muß für uns klar sein, daß die Zurückhaltung oder Ablehnung vieler Gruppen auf Erfahrungen mit gemischten Organisationen beruht. Die autonome Organisierung als Immigrantinnen oder Frauen ist keine Spaltung, sondern eine eigenständige, politische Organisationsform, die auf der Erfahrung beruht, daß die spezifischen Interessen in gemischten Strukturen nicht berücksichtigt werden oder eine eigenständige Entwicklung dort nicht möglich ist.
Aufgrund der negativen Erfahrungen in gemischten Zusammenhängen sind wir dafür, auf Frauen- und Immigrantinnengruppen von uns aus Schritte zu zu machen. Dies bedeutet die Auseinandersetzung, sprich die Kritik an gemischten Organisationsformen zu suchen und uns vor allem in der, Praxis aktiv zu den verschiedenen Unterdrückungsverhältnissen zu verhalten. Es muß aus unserer politischen Arbeit ersichtlich werden, daß wir alle Unterdrückungsverhältnisse bekämpfen und nicht nur Teilaspekte des bestehenden Systems (z.B. kapitalistische Ausbeutung). Es ist zwar etwas unglücklich, wenn heute viele Flugblätter alle vorhandenden „Antis“ aneinanderreihen, aber die Intention, die dahinter steckt, ist die richtige: Unser Kampf hat viele Wurzeln, viele Hindernisse, viele Gegner. In diesem Zusammenhang halten wir es für klar, daß eine politische Organisation als solidarische Unterstützerin auch dann ansprechbar ist, wenn die politischen Inhalte von anderen formuliert werden.
- Praktische Regelungen oder Garantien sollten in einer Organisation mitenthalten sein. Nur so läßt sich vielleicht einmal das zerbrochene Vertrauen wieder zurückgewinnen:
- autonome Organisierung innerhalb einer politischen Organisation und Quotierungen müssen selbstverständlich sein, wenn sie gewollt werden
- Texte sollten in verschiedenen Sprachen verfaßt werden
- in einer Organisation muß für Unterprivilegierte (Illegale, niedriger bezahlte Frauen usw.) ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden
- in der Zusammenarbeit mit Immigrant- Innen muß klar sein, daß für diese eine Anti-Nazi-Aktion die Abschiebung zur Folge haben kann, das heißt für Leute mit EG-Paß, gegebenfalls ihre Aufgaben zu übernehmen
- Frauen müssen unter sich entscheiden können, ob ein Mann, von dem sich eine Frau gefährdet fühlt, aus gemischten Strukturen ausgeschlossen wird
- wir müssen beim Aufbau einer Organisation die von Frauen und Immigrantinnen gemachten Erfahrungen (Frauen in den Befreiungskriegen, die danach zurück an den Herd „durften“; Immigrantinnen bei den französischen Partisanen, die von der kommunistischen Parteiführung regelrecht verkauft wurden usw.) berücksichtigen und sie vor allem neuen, weniger politisierten Leute vermitteln.
6.) Welche Bedeutung haben internationale Zusammenhänge für unseren Ansatz?
Entmystifizierung von „Übervätern“
Befreiung kann kein nationales Projekt sein. Solange Menschen geknechtet werden, gibt es keine Inseln der Glückseligkeit. Aufgrund der internationalen Ausbeutungsverhältnisse können wir uns als Linke nicht darauf beschränken, die Situation hier in der BRD isoliert davon zum Thema zu machen. Zudem haben die Globalisierung des Weltmarktes und die neuen Kommunikationsverbindungen dazu geführt, daß politische Projekte, die nicht über nationalstaatliche Grenzen hinwegdenken, scheitern müssen. Es ist deshalb selbstverständlich, daß Internationalismus tragender Bestandteil der angestrebten Organisation sein muß.
Wir wollen dabei das unkritische Verhältnis, das viele Linke zu Befreiungsbewegungen im Trikont hatten und haben, nicht wiederholen. Internationale Zusammenarbeit erfordert die gleichen Bedingungen wie die in einem Land: Ehrlichkeit, Beteiligung an Diskussionen, Kritik und -falls die Projekte nicht zusammenpassen- auch Bruch. In der Mittelamerika-Arbeit dagegen wurden FMLN und FSLN bejubelt, ihre internen Diskussionen nicht verfolgt, die Sozialdemokratisierung großer Fraktionen ignoriert. Das gleiche gilt für die Palästina-Arbeit, die Kurdistan-Solidarität, das Verhältnis zu den realsozialistischen Staaten. Immer wieder hat sich die BRD-Linke Überväter gesucht, an deren Stärke sie sich festhalten konnte. Gegenargumente wurden als „Metropolenchauvinismus“ oder „unsolidarisch“ abgekanzelt. Wir sehen zwar durchaus die Gefahr metropolenchauvinistischer Besserwisserei, aber genauso lehnen wir die unkritische Unterstützung für alles, was anderswo irgendwie antiimperialistisch erscheint, ab.
Ebenso müssen wir natürlich auch auf ihre Kritik an uns Wert legen bzw. sie einfordern.
Auf der anderen Seite erscheint uns die inzwischen weit verbreitete Position falsch, nach der jeglicher Befreiungsnationalismus nicht unterstützenswert ist. Viele antiimperialistisch-nationalistische Organisationen im Trikont (z.B. Kurdistan) oder in der europäischen Peripherie (Euzkadi, Nordirland) repräsentieren nach wie vor die fortschrittlichsten Bevölkerungsteile und sind Garanten für eine antirassistische, sozialistische Politik vor Ort.
In diesem Sinne sollten wir uns je nach Bedingungen in den verschiedenen Bewegungen und Organisationen nach internationaler Zusammenarbeit umsehen. Dies können sowohl Community-Selbsthilfen sein als auch Gewerkschaften, politische Organisationen oder Guerillas. Die wesentliche Frage ist dabei, inwieweit politische Diskussion möglich ist. Weder Antiimperialismus/-kapitalismus noch Basisorientierung sind alleine ausreichende Kriterien.
Daß es verschiedene Konzepte von Nationalismus gibt, dürfte inzwischen bekannt sein und sollte weiterhin diskutiert werden.
7.) Wie können weniger politisierte Leute in den Organisationsprozess eingebunden werden?
Mehr „Sendungsbewußtsein“
Für uns stellt die Einbindung von neuen Leuten eine Grundlage der Arbeit dar. Die Offenheit gegenüber anderen und der Wunsch, sich gemeinsam mit anderen zu organisieren, ist für unseren Erfolg unverzichtbar. Dafür muß die Linke mit mehr „Sendungsbewußtsein“ als in autonomen Zusammenhängen üblich auftreten.
Konkret sind die Darstellung nach außen, eine öffentlich bekannte Kontaktadresse, Einführungsgespräche für Interessierte usw. notwendig.
Es reicht jedoch nicht, neuen Leuten die Mitarbeit theoretisch anzubieten. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, sich aktiv in die Arbeit einzubringen und sich zu entfalten. Deshalb ist die Beteiligung am Plenum allein nicht ausreichend.
Grundsätzlich gilt es dabei, die weitere Herausbildung von Hierarchien in Gruppen zwischen erfahrenen Macherinnen und Unwissenden zu verhindern. Das bedeutet, daß sowohl bei neu Dazukommenden als auch bei „älteren“ Gruppenmitgliedern die Bereitschaft zu lernen, Wissen zu vermitteln, Kritik anzunehmen und zu verteilen, bestehen muß. Wichtig ist auch, daß die unterschiedlichen Charaktere der Leute berücksichtigt werden. Wir können uns nicht alle an der gleichen Meßlatte messen, nicht alle lernen gleich schnell, nicht alle interessiert dasselbe, und vor allem wollen nicht alle das gleiche von einer Gruppe: bei manchen überwiegt der Wunsch nach einem sozialen Zusammenhang, bei anderen die politischen Ziele. Beides ist notwendig.
Wir halten es auch für wichtig, daß sich eine politische Gruppe für Alltagsprobleme zuständig hält. Wenn z.B. ein Jugendlicher keinen Ausbildungsplatz bekommt, ist der Ratschlag „organisiere dich gegen das Kapital und kämpfe“ keine Hilfe. Als politische Leute müssen wir auch versuchen, konkrete Probleme für uns Nahestehende zu bewältigen. Die Glaubwürdigkeit, daß Organisation tatsächlich etwas weiterbringt, wächst bei solchen kleinen Erfolgen oft mehr als bei Demonstrationen, deren Ergebnis für die Beteiligten unkonkret bleibt. Gerade wenn Leute erst anfangen, sich zu organisieren, suchen sie mehr als nur die Übereinstimmung in politischen Analysen.
„(...) Ich kenne die Wirklichkeit in der BRD natürlich sehr wenig. Aber am wichtigsten fände ich, daß die Linke hier mehr mit der Bevölkerung zu tun hat, daß sie aufhört,, von den „normalen Leuten“ zu reden, daß sie sich als Teil dieser Gesellschaft erkennt. Dieses Argument, daß man sich abgrenzen müsse, um überhaupt links zu sein, erscheint mir völlig unsinnig.
Zum anderen ist die Linke unorganisiert. Das hat Vor- und Nachteile. Die Autonomie der westdeutschen Linken hat ihr eine große Lebendigkeit eingehaucht, sie ist nicht zusammengebrochen, als der Realsozialismus fiel. Das ist sehr positiv. Unabhängig davon, ob es viele sind oder nicht, die Linke hier lebt. Die Größe spielt da nur eine Nebenrolle.
Die negative Seite ist die Aufsplitterung in unzusammenhängende, lose bestehende Grüppchen. Die BRD-Linke ist sehr sektiererisch, auch die Autonomen. Die Frage ist also, wie diese vielfältige Autonomie aufrecht erhalten werden kann und sich gleichzeitig Kräfte mir gemeinsamen Zielen bündeln.
Ihr müßtet lernen, mit Unterschieden umzugehen und dennoch eng zusammenzuarbeiten. Wenn das gelingen würde, wäre das eine ziemlich interessante Synthese.“
(Eleuterio Ferncindez Huidobro aus der arranca! Nr.3)
Trackback URL für diesen Artikel
Erschienen in arranca! #4
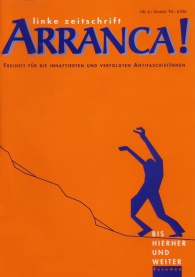

Kommentare
Kommentar hinzufügen